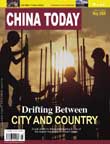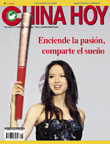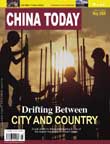Neben dem Unterricht beschäftigte sie sich noch mit Übersetzungen. Sie übersetzte die dramatische Ballade „Wang Gui und Li Xiangxiang“ von Li Ji ins Deutsche, die 1954 vom Verlag für fremdsprachige Literatur in Beijing herausgebracht wurde. Wang Gui, ein Hirte, und Li Xiangxiang, eine Magd, beide bei einem Grundbesitzer arbeitend, sind Hauptfiguren in dieser Ballade. Sie verlieben sich ineinander. Für ihre Liebe kämpfen sie gegen den Grundbesitzer. Mit Unterstützung einer Gruppe von revolutionären Kämpfern heiraten die zwei. Aber drei Tage nach der Heirat tritt Wang Gui der Gruppe bei und nimmt Abschied von Xiangxiang.
Zhu Bailan wurde 1954 in China eingebürgert. 1959 nahm sie als Mitglied der chinesischen Delegation am Jubiläum zur 10–jährigen Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und der Deutschen Demokratischen Republik in Ostberlin teil. 1963 trat sie dem Chinesischen Schriftstellerverband bei. In der Erinnerung ihrer Schüler war sie leicht zugänglich und aufrichtig. Mit ihrem Schüler Zhang Penggao kam sie so gut aus, dass sie wie Sohn und Mutter waren.
1971 litt sie unter der Leberzirrhose. Die Leitung der Universität ließ Zhang seine Lehrerin betreuen und zum Krankenhaus begleiten. Schließlich starb sie an Aszites (Bauchwassersucht). Bis zu ihrem Tod blieb noch das Foto mit ihr und Zhu Rangcheng an der Wand hängen. Ihrem Testament entsprechend wurden der Universität alle ihre Bücher gespendet und der Haushälterin ihr angespartes Geld geschenkt.
Zhu Rangchengs Verbleib war da noch unbekannt. Trotzdem erkundigten sich seine Freunde und Bekannten bei jeder Gelegenheit nach Rangcheng – ohne Erfolg. Während der Sohn von Zhu Rangcheng vier Jahre in der Sowjetunion studierte, waren keine Informationen zu bekommen. Anfang 1990 bekam die Familie Zhu mit Unterstützung beider Regierungen endlich eine Nachricht über das Geschehene. Laut eines Befehles des höchsten Sowjets der Sowjetunion wurde Zhu Rangcheng demnach im April 1938 von der Volkskommission für innere Angelegenheiten der Kasachischen SSR verhaftet und im Juni 1939 als Spion dazu verurteilt, acht Jahre im Arbeitslager zu verbringen. Am 17. Januar 1943 starb er in einem Arbeitslager in Sibirien. Im selben Jahr berichtigte die sowjetische Regierung die falsche Beschuldigung gegen Zhu Rangcheng, die zu seiner Verhaftung geführt hatte.
1994 holte sein Sohn ein Glass Erde aus Sibirien nach Shanghai und ließ es zusammen mit der Asche seiner Mutter auf dem Friedhof Fushou beerdigen, der in Qingpu bei Shanghai liegt. Die Inschrift auf dem Grabstein ist von Xia Yan verfasst, einem bekannten Schriftsteller und besten Kollegen von Rangcheng in der Theatertruppe. Pan Hannian, Berater des Theatertrupps, wurde auf dem gleichen Friedhof begraben. Die beiden waren die intimsten Freunde von Zhu Rangcheng.
*Dieser Artikel bezieht sich auf den Artikel „Klara Blum, eine jüdische Dichterin verliebt sich in Zhu Rangcheng, den bekannten chinesischen Regisseur“ aus dem Buch „Die kulturellen Eliten der Juden in Shanghai“ von Xu Buzeng.