Eine
alte Kunst lässt man wieder aufleben – die tibetschie Oper
Von
Hu Jin’an

Die tibetische Oper ist eine der ältesten
Formen der Schauspielkunst, zieht man die nationalen Minderheiten
Chinas in Betracht. Hunderte von Jahren wurde diese Art der
Oper sowohl in Tibet als auch in den Provinzen Sichuan, Qinghai,
Gansu und Yunnan aufgeführt, überall dort, wo größere
Gemeinschaften von Tibetern zu finden sind.
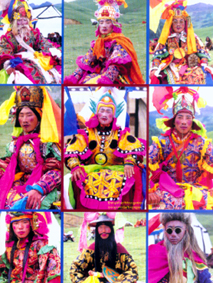 Die
Ursprünge dieser Oper kann man bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen,
der Zeit, als der tibetische König Trisung Detsan (742
– 797), ein gläubiger Buddhist, den berühmten indischen
Mönch Padma Sambhava nach Tibet einlud, um zu predigen
und zu lehren. Im Jahre 779 arbeitete Padma Sambhava einen rituellen
„Zauberer-Tanz” aus, um die Fertigstellung des Samye-Klosters
zu feiern. Basierend auf einer Geschichte aus den buddhistischen
Sutras schloss dieser Tanz Bewegungen aus dem lokalen Volkstanz
in sich ein und wurde aufgeführt, um böse Geister zu vertreiben
und die Götter durch eine Art von Pantomime geneigt zu
machen. Dieser Tanz gilt als Vorläufer der tibetischen
Oper.
Die
Ursprünge dieser Oper kann man bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen,
der Zeit, als der tibetische König Trisung Detsan (742
– 797), ein gläubiger Buddhist, den berühmten indischen
Mönch Padma Sambhava nach Tibet einlud, um zu predigen
und zu lehren. Im Jahre 779 arbeitete Padma Sambhava einen rituellen
„Zauberer-Tanz” aus, um die Fertigstellung des Samye-Klosters
zu feiern. Basierend auf einer Geschichte aus den buddhistischen
Sutras schloss dieser Tanz Bewegungen aus dem lokalen Volkstanz
in sich ein und wurde aufgeführt, um böse Geister zu vertreiben
und die Götter durch eine Art von Pantomime geneigt zu
machen. Dieser Tanz gilt als Vorläufer der tibetischen
Oper.
Vom Ritus zur Kunst
Sechshundert Jahre später ließ
ein Lama namens Tangdon Jyalbo (1385 - ?) diesen Tanz aufführen,
um zu Geldmitteln für den Bau einer Brücke zu kommen. Um ihn
interessanter und die Religion betreffend belehrend zu
machen, flocht er in die ursprüngliche Form Episoden aus Volkserzählungen
und den buddhistischen Sutras ein. Diese Dramatisierung, bei
der dem Tanz Gesänge zugefügt waren, wurde bei der lokalen
Bevölkerung sehr beliebt. Und so wurde Tangdon Jyalbo als
Begründer der tibetischen Oper bekannt.
Später gab dann der fünfte Dalai Lama
(1617 – 1682) die Anweisung, dass die tibetische Oper getrennt
von religiösen Zeremonien aufgeführt werden sollte. So
wurde sie zu einer unabhängigen Kunstform. Obwohl bei der
Entstehung und der Entwicklung mit der Religion verbunden, wurzelte
sie im Volk und seinem alltäglichen Leben. Die Melodien
des ersten tibetischen Opernensembles, der Bundunba (sieben
Schwestern) – Truppe waren den Volksliedern, die als “Xaiqen”
bekannt sind, sehr ähnlich.
Die instrumentelle Begleitung steht in engem
Bezug zu derjenigen der tibetischen Trinklieder und –tänze
und den Goxai-Tänzen. Viele der Tanzbewegung gehen auf
die tagtäglichen Erfahrungen des Volkes zurück. Dies kann
vielleicht auch erklären, warum die tibetische Oper mit
unveränderter Popularität die Jahrunderte überdauert
hat.
Dauer und Struktur
Aufgeführt wurde die Oper im Freien
und dabei tauchten als Musikbegleitung nur Trommel und Zymbal
auf. Die Melodien, hoch und vollklingend, wurden mit Chorbegleitung
gesungen und wirkten, obwohl sehr laut vorgetragen, harmonisch.
Jede traditionelle Oper bestand aus drei Teilen:
dem Doin, dem Xong und den Zhaxi.
Im Doin, d.h. dem Prolog, dankte ein
Erzähler, Ngoinba (Jäger oder Fischer) genannt,
zunächst den Göttern und flehte um ihren Schutz. Dann
erläuterte er, oft mit Tanzbewegungen begleitet, die Handlung
und die Charaktere.
Der Hauptteil der Oper wurde Xong genannt.
Die Darsteller kamen hervor und stellten sich in einem Kreis
auf. Der Meister, normalerweise identisch mit dem Ngoinba,
erläuterte die Handlung, den Schauplatz und das Bühnenbild,
die Charaktere und Musikdrama in einem rhythmischen Monolog.
Bei den entsprechenen Stellen verließ dann der zugehörige
Darsteller den Kreis, um einige Verse zu singen, und kehrte
dann in den Kreis zurück, um mit den anderen zusammen zu tanzen
oder Akrobatikstücke vorzuführen. Dieser Wechsel dauerte bis
zum Ende der Vorführung, d.h. zwei oder drei Stunden oder auch
drei Tage, je nach dem Gutdünken des Meisters.
Der letzte Teil war der Epilog oder Zhaxi,
was auf tibetisch Segensspruch oder Prophezeiung bedeutet. Die
Darsteller sangen Segenswünsche, tanzten dabei einen Freudentanz
und schenkten dann zum Abschluss der Vorführung der Zugehörigkeit
Hadas (zeremonielle Seidentücher).
Ausdrucksmittel
Die Hauptausdrucksmittel der tibetischen Oper
sind: Gesang, Tanz, rhythmischer Monolog, Rezitieren, Akrobatik
und Schauspielern. Am wichtigsten ist der Gesang. Jede traditionelle
Oper hatte ihre Hauptmelodie oder ihr Thema, das sich ganz durchzog.
Auch zu jedem enzelnen Charakter gehörte eine bestimmte
Melodie, länger oder kürzer, je nachdem, wie die Situation
es erforderte. Es konnte auch eine andere Melodie, dann aber
nur eine einzige andere, in der Oper benutzt werden, etwa ein
Klagelied oder ein Volkslied. Diese Melodie kam dann allen Charakteren
zu.
Tanz und Akrobatik sind ebenfalls wesentliche
Elemente der tibetischen Oper. Die Tanzbewegungen hatten gewöhnlich
wenig Bezug zur Handlung oder den Gefühlen der dargestellten
Personen. Sie sollten dabei helfen, das Thema stärker zu
kontrastieren, die Stimmung zu variieren und so dabei zu helfen,
das Drama zum Höhepunkt zu bringen. Einige zeigen besondere
Handlungen an, wie etwa Marschieren oder Reiten. Gelegentlich
gingen die Darsteller während des Gesangs auch zu
Bewegungen des Volkstanzes über.
Die rhythmischen Monologe waren im allgemeinen
den männlichen Charakteren höherer gesellschaftlicher
Stellung vorbehalten. So entstand ein Eindruck von Würde und
Ansehen.
Rezitiert wurde sowohl in Versen als auch
in normaler Sprechweise. Die Verszeilen erfordern bei der tibetischen
Sprache eine genau festgestellte Anzahl von Wörtern pro
Stanze.
Beim Schauspielern verließ man sich
in der alten tibetischen Oper wesentlich auf Masken und Gesten.
Eine Ausnahme waren dabei die Spaßmacher mit ihrer lebhaften
und herzlichen Art und ihren humorvollen Gesichtsausdrücken.
Heute werden die Masken nicht mehr benutzt, außer wenn
es für die Handlung wesentlich ist. Jetzt wird mehr Betonung
auf Mimik gelegt. Dadurch wurde die Oper lebendiger und packender.
Die meisten Handlungen haben ihren Ursprung
in Geschichten und Biographien in den buddhistischen Sutras
oder in Volkserzählungen. Heute existieren noch dreizehn
traditionelle Opern. Davon werden aber nur noch acht häufig
aufgesführt. Obwohl die Stücke einfach sind, sind sie oft schön
und ergreifend. Die traditionelle tibetische Oper war sehr populär,
und es gab zahlreiche Truppen. Zwölf wurden gewöhnlich
offiziell dazu bestimmt, jedes Jahr am Shoton-Fest aufzutreten.
Amateur-Truppen traten in den ländlichen Gebieten auf,
an Straßenecken, in Klöstern und Tempeln. Jede Truppe
hatte ihren eigenen Stil und ihre Besonderheit. Es gab zwei
hauptsächliche Schulen, die der weißen und die der
blauen Masken, so genannt nach ihrer Aufmachung. Die erstere
war älteren Ursprungs, ihre Darbietungen waren ziemlich
einfach, und ihr Einfluss nahm allmählich ab. Die Schule
der blauen Masken, die später aufgekommen war, war ausgefallener,
und die vier größten Truppen dieser Richtung waren
berühmt. Am meisten angesehen war das Gyumolong-Ensemble.
Mit Mitgliedern dieses Ensembles als Kern enstand die Truppe
für tibetische Oper des autonomen Gebiets im Jahre 1960. Sie
verlagerte den Schauplatz dieser traditionellen Kunstform von
den öffentlichen Plätzen und Straßenecken auf
die reguläre Bühne. Dazu kamen ein Schminkraum, Bühnenrequisiten,
Lichteffekte und ein Orchester. Und als Ergebnis davon entstand
eine abgerundete Schauspielform.
Aus
„China im Aufbau“, Nr. 12, 1981

