Chinesische
Pavillons
Von
Feng Zhongping

In nahezu allen chinesischen
Gartenanlagen stehen Pavillons. Als abwechselungsreiches
und graziöses Gestaltungselement ragen sie von Berghängen
auf, stehen sie neben Hallen und Tempeln oder laden sie
am Ufer von Flüssen und Seen zur Rast ein.
Ein historischer Überblick
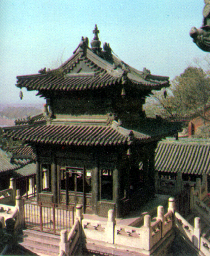 Schon
im Altertum Chinas wurden Pavillons gebaut. An Verkehrswegen
und städtischen Straßen standen Pavillons zum
Ausruhen. Über dem Stadttor stand meist ein Pavillon,
in dem der Flaggenmast aufgerichtet wurde. Die Wachen an
der Staatsgrenze schützten sich in Pavillons vor den Unbilden
der Witterung. Brunnen wurden oft mit Pavillons überdacht.
Ansonsten dienten sie meist dazu, mit Inschriften versehene
Steinstelen aufzubewahren, außerdem auch als Glocken-
und Trommeltürme.
Schon
im Altertum Chinas wurden Pavillons gebaut. An Verkehrswegen
und städtischen Straßen standen Pavillons zum
Ausruhen. Über dem Stadttor stand meist ein Pavillon,
in dem der Flaggenmast aufgerichtet wurde. Die Wachen an
der Staatsgrenze schützten sich in Pavillons vor den Unbilden
der Witterung. Brunnen wurden oft mit Pavillons überdacht.
Ansonsten dienten sie meist dazu, mit Inschriften versehene
Steinstelen aufzubewahren, außerdem auch als Glocken-
und Trommeltürme.
Nach den Überlieferungen
sind Pavillons als Gebäudeform auf die Sui-Zeit zurückzuführen,
in der man sie zum ersten Mal in die Gartenbauarchitektur
einführte, und damit schon 1500 Jahre alt. In Xiyuan (dem
heutigen Luoyang in Henan) z. B. hatte Yang Guang, der zweite
Kaiser der Sui-Zeit, beim Stadtbau einen prächtigen
„Lustpavillon“ anlegen lassen. Während der Tang-Zeit
(618–907) befanden sich allein in den kaiserlichen Gärten
nördlich der Hauptstadt Chang’an (dem heutigen Xi’an
in Shaanxi) insgesamt vierundzwanzig Pavillons. Weiteren
Aufzeichnungen zufolge gab es zur gleichen Zeit einen Pavillontyp
namens Ziyuting. Über sein Dach wurde permanent Wasser
geleitet, so dass es darunter immer schön kühl war.
Überhaupt fanden Pavillons in der Zeit vom 14. bis
zum 19. Jahrhundert überall in großem Ausmaß
Verwendung im Gartenbau. Manche davon sind noch heute erhalten.
Merkmale
 Pavillons,
ob groß, ob klein, lassen sich vielfältig und
zu jeder Umgebung passend gestalten. Ihre Formgebung hängt
von der vorhandenen Fläche, der gewünschten Konstruktion
und der Dachart ab.
Pavillons,
ob groß, ob klein, lassen sich vielfältig und
zu jeder Umgebung passend gestalten. Ihre Formgebung hängt
von der vorhandenen Fläche, der gewünschten Konstruktion
und der Dachart ab.
Wegen seiner guten Verarbeitungs-
und Transportfähigkeit wurde im Altertum immer Holz
als Baumaterial für Pavillons und andere Gebäude verwendet.
Dies ermöglichte günstige Formgebungen, die der damaligen
und auch der heutigen Ästhetik entsprachen. Zusammen
mit ihrem vielfach gegliederten Dach, den lackierten Säulen
und dem steinernen Sockel fügen sich die Pavillons so stimmig
in die Umgebung ein, dass sie als Bauwerke aus den anderen
Zweckbauten weit herausragen.
Chinesische Pavillons zeichnen
sich durch ihre kunstvollen Dachkonstruktionen aus. Beim
Spitzdach laufen alle Dachfirste von der Mitte der sie tragenden
Säulen in einem eleganten Kurvenverlauf spitz in der
Mitte zusammen, wo sie von einem Dachornament abgeschlossen
werden.
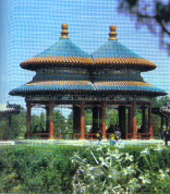 Die
Ecken der Dachtraufen sind im Allgemeinen hochgezogen. In
Nordchina werden sie leicht, in Südchina stark nach oben
gebogen. Die nordchinesischen Dächer wirken so eher
sicher und ruhig, die südchinesischen elegant.
Die
Ecken der Dachtraufen sind im Allgemeinen hochgezogen. In
Nordchina werden sie leicht, in Südchina stark nach oben
gebogen. Die nordchinesischen Dächer wirken so eher
sicher und ruhig, die südchinesischen elegant.
Die Pavillons in den kaiserlichen
Gärten Nordchinas sind normalerweise mit farbig glasierten
Ziegeln, roten Säulen und buntbemalten Balken sowie
mit schneeweißen Marmorgeländern und Sockeln
versehen. In südchinesischen Gärten pflegt man die
Pavillons mit grauen Ziegeln zu decken; die Balken sind
meist dunkelbraun gehalten, was die Eleganz ihrer Dächer
durch die Schlichtheit des Pavillonkörpers noch verstärkt.
Chinesische Pavillons waren
ursprünglich alle viereckig und klein. Ihr Holzdach war
gewöhnlich nur mit Stroh oder Ziegeln gedeckt. Mit
der Zeit bildeten sich vieleckige, kreis- und kreuzförmige
und andere Typen heraus, darunter auch Pavillonkomplexe
und zweistöckige Pavillons.
Baustile
In China sind heute folgende
Pavillontypen anzutreffen:
–
Dreieckige
Pavillons mit Spitzdach: Bei dieser Pavillonform wird das
Dach von drei Säulen gestützt. Ein Beispiel dafür ist
der dreieckige Pavillon auf der Insel Santanyinyue („Mondspiegelungen
bei den drei steinernen Pagoden“) im Westsee bei Hangzhou.
–
Mehreckige
Pavillons mit ein- oder mehrstufigem Dach: Ihre Dächer
sind ebenfalls spitz, ihre Form dagegen sieht sechs oder
acht Ecken vor. Ihre Konstruktion ist schlicht, deshalb
aber nicht weniger würdevoll. Solche Pavillons können
separat oder als Unterbrechung und Auflockerung eines Wandelganges
errichtet werden. Pavillons in Wandelgängen heben sich
stets durch ihre mehrfach abgesetzten Dachkonstruktionen
vom Gang selbst ab. Derartige Pavillons sind in den kaiserlichen
Gartenanlagen Nordchinas sehr häufig anzutreffen; der
achteckige Pavillon im Sommerpalast von Beijing ist das
größte Bauwerk dieser Art in China. Die Pavillons
mit mehrfach abgesetzten Dächern sind wohl die ausgefeilteste
Bauform; jedoch ist „mehr“ dabei nicht unbedingt besser.
Ein dreifaches Dach lässt sich von einem vier- oder
fünffachen durchaus nicht übertreffen. In diese Kategorie
gehört der Wanchun-Pavillon (Pavillon des ewigen Frühlings)
auf dem Berggipfel des Jingshan in Beijing. Als Mittelpunkt
vierer weiterer symmetrisch angeordneter Pavillons ragt
er aus ihrer Linie hervor und bilden einen harmonischen
Kontrapunkt zum gegenüberliegenden Kaiserpalast.
–
Pavillons
mit einem Juanpeng- oder Xieshan-Dach: Diese beiden Dachformen
ähneln Sattel- und Walmdächern, haben aber ihre
traditionellen chinesischen Eigenarten. Während das
Juanpeng-Dach keinen deutlich sichtbaren Dachfirst hat,
da sein oberer Teil zu einer Wölbung abgeflacht ist,
besteht das Xieshan-Dach an seinem Unterteil aus vier abgeschrägten
Dachflächen, auf die ein „normales“ Dach mit zwei senkrechten
Giebeln gesetzt wird. Dieser Pavillontyp ist recht- oder
achteckig, trapez- oder fächerförmig. Bei dieser
Pavillonform ist die offene Seite der schönsten Landschaft
zugewandt; an der Rückseite und den anderen Seiten, falls
vorhanden, werden die weißen Wände durch formenreiche
Aussichtsfenster aufgelockert.
–
Pavillongruppen:
Diese Konstruktion besteht aus zwei oder mehr ineinandergeschachtelten
Bauten. Der Hui-Pavillon auf dem „Berg der Langlebigkeit“
im Sommerpalast z. B. ist aus zwei sechseckigen Pavillons
zusammengesetzt. Wenn man ihn vom Kunming-See aus sieht,
sieht er aus wie zwei große Seite an Seite stehende,
geöffnete Regenschirme. Im Beihai-Park in Beijing ist
ein weiteres Beispiel zu finden, der Fünf-Drachen-Pavillon.
Fünf Pavillons sind in einer bestimmten Komposition angeordnet.
Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele für die
Kombination von Pavillons.
–
Halbpavillons:
Wenn ein Pavillon an eine Wand angefügt wird, entsteht –
der Name sagt es bereits – ein Halbpavillon. Es ist auch
möglich, in einen Wandelgang einen Halbpavillon einzufügen,
indem nämlich ein Teil des Wandelganges einfach zur
Seite ausgebaut wird.
–
In
Süd- und Nordchina gibt es noch jeweils einen Bronzepavillon.
Der im Süden, Jindian genannt, wurde im Jahre 1670 aus Bronze
und Messing gegossen. Er steht in einem nördlichen
Vorort der Stadt Kunming, wo damals Bronze produziert wurde
und die Gusstechnik gut entwickelt war. Der andere stammt
aus dem Jahre 1750 und findet sich im Sommerpalast.
Der richtige Pavillon
am richtigen Platz
 Die
chinesischen Pavillons dienen zum Genuss der Landschaft,
doch gleichzeitig verschönern sie sie. Daher müssen
sie sich harmonisch in ihre Umgebung einfügen, so dass sie
selbst Teil (und schöner Teil) der Gesamtszenerie werden.
Ihre Anordnung spielt dabei eine bedeutsame Rolle. In den
nordchinesischen kaiserlichen Gärten gibt es viel Raum,
die Sicht reicht weit. Für die Aufstellung von Pavillons
ist es somit zweifelsohne erforderlich, diese Eigenschaften
auszunutzen. So wandert der Blick vom Zhichun-Pavillon am
östlichen Ufer des Kunming-Sees im Sommerpalast zum
„Berg der Langlebigkeit“ im Norden und hinüber zum Damm
im Westen und der Insel im Süden; dem Betrachter bietet
sich die Landschaft der endlosen traditionellen chinesischen
Bildrollen.
Die
chinesischen Pavillons dienen zum Genuss der Landschaft,
doch gleichzeitig verschönern sie sie. Daher müssen
sie sich harmonisch in ihre Umgebung einfügen, so dass sie
selbst Teil (und schöner Teil) der Gesamtszenerie werden.
Ihre Anordnung spielt dabei eine bedeutsame Rolle. In den
nordchinesischen kaiserlichen Gärten gibt es viel Raum,
die Sicht reicht weit. Für die Aufstellung von Pavillons
ist es somit zweifelsohne erforderlich, diese Eigenschaften
auszunutzen. So wandert der Blick vom Zhichun-Pavillon am
östlichen Ufer des Kunming-Sees im Sommerpalast zum
„Berg der Langlebigkeit“ im Norden und hinüber zum Damm
im Westen und der Insel im Süden; dem Betrachter bietet
sich die Landschaft der endlosen traditionellen chinesischen
Bildrollen.
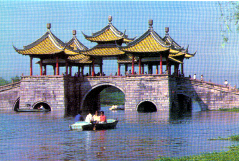 Die
Privatgärten der Literati in Südchina sind dagegen
durch beschränkten Raum und ein eingeschränktes
Sichtfeld charakterisiert. Demzufolge liegt hier der Schwerpunkt
auf der Anordnung der Pavillons, auf ihrem „Gewicht“ im
Verhältnis zu den anderen Dingen im Garten – Berge,
Bächer, Brücken, Blumen und Bäume –, auf einer
wohldurchdachten Konzeption also, die auch in einem kleinen
Garten eine absechselungsreiche Landschaft zu schaffen in
der Lage ist und so einen künstlerischen Effekt hervorbringt,
der den beschränkten Raum groß erscheinen lässt.
Die
Privatgärten der Literati in Südchina sind dagegen
durch beschränkten Raum und ein eingeschränktes
Sichtfeld charakterisiert. Demzufolge liegt hier der Schwerpunkt
auf der Anordnung der Pavillons, auf ihrem „Gewicht“ im
Verhältnis zu den anderen Dingen im Garten – Berge,
Bächer, Brücken, Blumen und Bäume –, auf einer
wohldurchdachten Konzeption also, die auch in einem kleinen
Garten eine absechselungsreiche Landschaft zu schaffen in
der Lage ist und so einen künstlerischen Effekt hervorbringt,
der den beschränkten Raum groß erscheinen lässt.
Der Auto ist Dozent an der
Architektur-Abteilung der Qinghua-Universität. Er ist
der Verfasser des Werks „Die Architektur der Chinesischen
Gartenanlagen“.
Aus
„China im Aufbau“, Nr. 6, 1983

