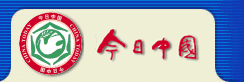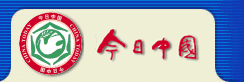Der
Taoismus und der Tempel der
Weißen Wolken
 DER
in Beijing gelegene Tempel der Weißen Wolken (Baiyun Guan) ist der
älteste taoistische Tempel und der Ursprungsort der Sekte Quanzhen
(Bewahrung des Wahrhaften). Hier hat die Chinesische Gesellschaft
der Taoisten ihren Sitz. DER
in Beijing gelegene Tempel der Weißen Wolken (Baiyun Guan) ist der
älteste taoistische Tempel und der Ursprungsort der Sekte Quanzhen
(Bewahrung des Wahrhaften). Hier hat die Chinesische Gesellschaft
der Taoisten ihren Sitz.
Der Taoismus ist eine in China entstandene
Religion. Seine Ursprünge reichen weit zurück, doch als Religion
begründet wurde der Taoismus erst im 2. Jahrhundert von Zhang Daoling
(34-156), der in Sichuan die Sekte Zhengyi (Aufrichtigkeit und Einheit)
ins Leben rief. Später wurde Zhang Daoling von seinen Anhängern
als „Himmelsmeister“ verehrt , und die Zhengyi-Sekte wurde auch
Sekte des Himmelsmeisters genannt. Als der eigentliche Schöpfer
der taoistischen Philosophie aber gilt Laotse, ein Denker in der
Frühlings- und Herbstperiode (770-476 v. Chr.). Das Buch „Tao-te-king“,
in dem Laotses Lehre aufgeschrieben ist, gilt den Taoisten als ihr
Kanon.
Die Taoisten glauben an die Existenz
des allumfassenden und immerwährenden „Tao“. Ihrer Meinung nach
hat das Tao Himmel und Erde geschaffen, und durch Meditation und
ein tugendhaftes Leben solle man danach streben, mit dem Tao eins
zu werden.
In den zweitausend Jahren seines Bestehens
übte der Taoismus einen großen Einfluß auf die Philosophie, Medizin,
Literatur, Kunst und Ethik sowie die Sitten und Bräuche der chinesischen
Nation aus. Er ist nicht nur auf dem Festland Chinas, sondern auch
in Hongkong, Macao, auf Taiwan und unter den Auslandchinesen verbreitet.
Im Taoismus gibt es mehrere Sekten, davon
sind die größten: die Zhengyi im Süden Chinas und die Quanzhen im
Norden. Erstere legt besonderen Wert auf fromme Andachten, während
letztere die individuelle Meditation betont. Die umfangreichste
Sammlung taoistischer Schriften sind die „Taoistischen Werke“ aus
der Ming-Dynastie (1368-1644), die 5485 Bände zählen.
Taoistische Tempel sind in ganz China
verbreitet. Sie wurden vor allem in bekannten Bergen gebaut. Berühmt
sind die Tempel im Longhu-Berg in der Provinz Jiangxi, im Qingcheng-Berg
in der Provinz Sichuan, im Wudang-Gebirge in der Provinz Hubei,
im Maoshan-Berg in der Provinz Jiangsu, im Taishan-Gebirge in der
Provinz Shandong und im Huashan-Gebirge in der Provinz Shaanxi.
Insgesamt gibt es etwa 1600 taoistische Tempel auf dem Festland
Chinas, in denen rund 25000 taoistische Mönche und Nonnen leben.
Noch einige zehntausend wohnen außerhalb der Tempel. Über 2000 taoistische
Tempel gibt es auf Taiwan und mehr als 100 in Hongkong und Macao.
Seit der Gründung der Volksrepublik im
Jahre 1949 wird in China eine Politik der Religionsfreiheit praktiziert.
Im April 1957 fand eine Landeskonferenz der Taoisten statt, auf
der die Chinesische Gesellschaft der Taoisten ins Leben gerufen
wurde. Der Tempel der Weißen Wolken wurde während der Regierungszeit
des Tang-Kaisers Kaiyuan (713-741) gebaut und hieß zunächst Tianchang
Guan (Tempel des Weiten Himmels). Die Laotse-Statue aus Marmor,
die in dem Tempel steht, stammt noch aus der Tang-Zeit. 1224 kam
Qiu Changchun, ein Jünger Wang Chongyangs , des Begründers der Quanzhen-Sekte,
aus Shandong nach Beijing. Unter seiner Anleitung wurden mehrere
Hallen neu gebaut. 1227 wurde der Tempel von Dschingis Khan in Changchun
Gong (Palast des Ewigen Frühlings) umbenannt, und kurz darauf wurde
er zum Zentrum der Longmen-Sekte, eines Zweigs der Quanzhen-Sekte.
Als Qiu Changchun starb, bauten seine Jünger zum Andenken an ihrem
Meister östlich des Changchun Gong einen Hof namens Baiyun Guan.
Mitte des 14. Jahrhunderts ließ Kaiser Zhu Di der Ming-Dynastie
den Changchun Gong renovieren, wodurch der Tempel die heutige Gestalt
bekam. 1443 stiftete der Ming-Kaiser Yingzong eine Tafel mit der
Inschrift „Baiyun Guan“. Seitdem hat der Tempel diesen Namen.
Zu Beginn der Qing-Dynastie setzte eine
Blütezeit des Tempels ein. Während der Regierungszeit des Kaisers
Sunzhi (1644-1661) nahm Wang Changyue, Abt der siebten Generation
der Longmen-Sekte, dreimal im Baiyun Guan rund tausend Schüler auf.
Der Tempel wurde mehrmals erweitert. In den Regierungszeiten der
Kaiser Qianlong (1736-1796) und Jiaqing (1796-1821) wurden die Hallen
auf der östlichen und der westlichen Seite gebaut, und 1887 wurde
mit Geldspenden des Eunuchen Liu Chengyin der sog. Hintere Garten
angelegt.
In den Jahren 1956, 1980 und 1999 wurde
der Tempel jeweils restauriert. Die letzte Restaurierung kostete
über 25 Millionen Yuan, die teils von der Regierung und teils von
Taoisten aus Hongkong aufgebracht wurden. Alte Bauten und farbige
Wandgemälde wurden wiederhergestellt, 68 Skulpturen neu geschaffen,
und die ganze Tempelanlage wurde mit Brandschutzeinrichtungen und
Beleuchtungen ausgestattet.
Am 15. Oktober 2000 fand eine große Feier
anlässlich der Fertigstellung der Renovierung statt. Daran nahmen
über 1000 Menschen teil, neben geladenen Persönlichkeiten Taoisten
aus verschiedenen Landesteilen sowie aus Hongkong und Macao.
Die Tempelanlage nimmt eine Fläche von
60000 qm ein. Die Gebäude machen ein Sechstel der Gesamtfläche aus.
Über 20 Hallen stehen hier, darunter die Halle des Jadekaisers,
die Halle der Vier Heiligen, die Halle der Drei höchsten Gottheiten
und die Halle der Acht Unsterblichen. Im hinteren Teil liegt der
stille Yunji-Garten. Hier befinden sich schöne Pavillons, bizarre
Felsen und das Yunji-Haus mitWandelgängen.
Zu den wertvollsten Schätzen des Tempels
zählen Steintafeln mit dem Text des „Tao-de-king“, dessen Schriftzeichen
nach der Handschrift Zhao Mengfus, eines berühmten Kalligraphen
der Yuan-Zeit, eingraviert wurden, die mingzeitliche Auflage der
„Taoistischen Werke der Regierungsperiode des Kaisers Zhengtong“,
die der Kaiser Yingzong dem Tempel geschenkt hatte, eine goldene
Glocke, die vom Kaiser Kangxi der Qing-Dynastie gestiftet wurde,
sowie gestickte Banner und Gewänder, die die Kaiserinwitwe Cixi
geschenkt hatte. Aufbewahrt sind ferner viele taoistische Rollbilder,
Tafeln mit Inschriften, die von den Kaisern Kangxi und Qianlong
geschrieben wurden, und ein Gemälde der Kaiserinwitwe Cixi mit dem
Titel „Winterkirsche“.
Der Baiyun Guan ist heute eine
von in- und ausländischen Touristen vielbesuchte
Stätte. Jährlich am Frühlingsfest findet hier ein großer Tempelmarkt
statt. Tausende von Menschen kommen dann hierher, und kaum keiner
vergisst, einen Steinaffen hinter dem Eingangstor zu streicheln
und Geld durch ein „Münzenloch“ zu werfen, denn beides, so glaubt
man, bringe Glück.
Von
Tang Zheng
|