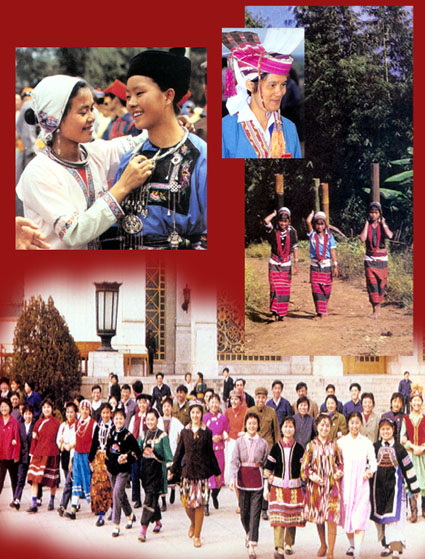Die
Trachten der nationalen Minderheiten
Von
Yi Xu
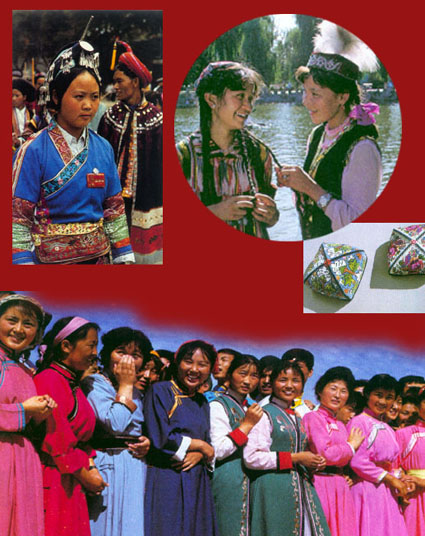
Unterschiede in Geschichte, Geographie,
Kultur, Sitten und Lebensumständen unter Chinas 55 nationalen
Minderheiten haben zu einer atemberaubenden Vielfalt traditioneller
Trachten geführt.
Das Spinnen von Garn aus Baumwollfasern
und das Weben von Baumwollstoff kam zuerst unter in Südchina
lebenden Völkern auf. Die Han, Chinas Mehrheitsvolk,
trugen ursprünglich nur Kleidung aus Leinen oder Seide. Auch
heute noch tragen viele Minderheitsangehörige im Süden
Kleider aus Baumwolle, die auf traditionellen Webstühlen gewoben
wurden.
Viele Nationalitäten, besonders solche
im Süden, kreieren Stoffmuster, indem sie dicke weiße
Fäden über mehrere Fäden der Gewebebasis ziehen
– im wesentlichen eine Brokattechnik. Seit über tausend Jahren
fertigen die Zhuang und andere Völker kunstvolle Muster
mit schweren Fäden in den verschiedensten Farben an.
Die schönen Stoffe werden für Schultertaschen, Gürtel,
Kopfbedeckungen u. ä. verwendet.
In der Provinz Hunan verfertigen die Tujia-Frauen
große rechteckige Brokatstücke aus roter, gelber, weißer
und schwarzer Rohseide, die als Schürzen oder Capes dienen.
Sie sind ein unerlässlicher Teil der Mitgift jedes Tujia-Mädchens.
Die Brokate der Li-Nationalität in der Provinz Guangdong
mit ihren bunten, phantasievollen Mustern sind traditionell
der hauptsächlich verwendete Stoff für die röhrenförmigen
Röcke der Frauen dieses Volks. Die Dai in Yunnan sind
für die leuchtenden Farben ihrer Brokate bekannt. Und in Guizhou,
Hunan und Guangxi fangen die Dong-Dekors mit nur wenigen Linien
genau das ein, was dargestellt werden soll.
Im Hochland von Qinghai und Tibet, wo die
Viehzucht vorherrscht, ist die Wolle der wichtigste Grundstoff
für die Kleidung. Pulus, dicke grobe Wollstücke, sind nicht
nur von kunsthandwerklichem Reiz, sondern vor allem auch warm
und sehr haltbar. Sie werden zu Kleidung, Mützen und sogar
zu Stiefeln verarbeitet. Es gibt viele Arten von Pulus. Zum
Beispiel in dünne Bänder gewebte, die mit bunten horizontalen
Streifen versehen sind; sie werden auf besonders schmalen
Webstühlen hergestellt und zu wunderschönen Schürzen
zusammengenäht.
Große Vielfalt
Wenn sie in den eisigen Wintern Nordostchinas
auf Jagd gehen, tragen die Olunchun und Angehörige anderer
Nationalitäten pelzgefütterte Gewänder. Die losen
Ärmeln, lange genug, um Hände, die Zügeln halten,
zu bedecken, sind ein Kennzeichen der Tuniken kasachischer
Reiter. Die traditionelle chinesische Kleidung der uigurischen
Männer im fernen Nordwesten Chinas ist eine lange Robe,
die bestens gegen Wind und Sandstürme schützt.
Auf dem „Dach der Welt“ tragen die Tibeter
weite, langärmelige Mäntel, die auf einer Seite
zugeknöpft sind. Sie können rasch an- und ausgezogen
werden, was sehr praktisch ist, da die Temperaturen zwischen
Tag und Nacht stark schwanken. Nachts ist die Robe eine heimelig
warme Körperbedeckung. Wenn sich die Luft tagsüber aufheizt,
kann man den Mantel bequem „halb ausziehen“, indem man einen
Arm aus dem Ärmel gleiten lässt. Der Gürtel ist
unerlässlich, denn an ihn werden allerlei nützliche Dinge
und Ziergegenstände gehängt.
Die tibetische Tracht ist in mehrere Regionalstile
unterteilbar. In den Weidegebieten sind die Kleider der Frauen
mit einem Fellsaum versehen, während in Ackerbaugebieten
langärmelige Blusen, Pulu-Westen, farbenfrohe Gürtel
und Pulu-Schürzen getragen werden. Vor der Befreiung drückten
sich bei den Tibetern Standes- und Klassenunterschiede auch
sehr deutlich in der Kleidung aus.
Unter den Nationalitäten im Süden spielen
Schmuck und Verzierungen eine wichtige Rolle. Bei den Miao,
Dong und Buyi in Guizhou, besteht die Tracht der Frauen aus
Jacke, Rock, Schürze, Beinkleidern und Kopftuch, die mit Stickereien,
Kreuzstich- oder aufgemalten Mustern verziert sind. Die schönen
farbenprächtigen Dessins zeugen vom künstlerischen Talent
der Frauen.
Tiermotive und geometrische Muster
Die enge Verbundenheit der südchinesischen
Minoritäten mit der Natur zeigt sich auch am Dekor ihrer
Tracht: Viele Motive sind der Flora und Fauna entnommen, wobei
Stilisierung und absichtliche Übertreibung virtuos angewandte
Mittel des künstlerischen Ausdrucks sind. Bei den Miao, die
in den Bergen wohnen, ist die Darstellung von Vögeln,
Wildtieren und Schmetterlingen am verbreitesten; Grün ist
die beliebteste Farbe. In den Flusstälern hingegen werden
Fisch- und Garnelenmotive sowie rötliche Farbtönungen
bevorzugt. Manche Zhuang- und Dong-Brokate kommen pro Stücke
auf bis zu 200 Figuren.
Wie bei den Han sind auch bei den Minderheitsvölkern
Südchinas traditionelle Glückssymbole, etwa Drachen, Phönix,
Peonie oder Swastika, sehr beliebt. Zhuang und Tujia, zum
Beispiel, weben sie häufig in ihre Stoffe ein.
Auch geometrische Muster sind populär.
Die Yao stellen bei ihren Kreuzsticharbeiten gerne Dreiecke,
Rhomben und ähnliche Formen dar, während bei ihren
Stickereien Fischgrätmuster, Kreuzmuster, Streifen und
Wellenlinien grundlegende Zierelemente sind. Die Dong weben
Kreuz-, Zickzack-, Rechteck- und Sternchenmuster in ihre Stoffe.
Und die Dahuren im Nordosten bevorzugen radiale Muster.
Anders als die hauptsächlich blaue
und graue Kluft der Han sind die Trachten der nationalen Minderheiten,
besonders der Frauen, leuchtend bunt und farbenfroh. Sehr
beliebt sind rot, gelb, grün und weiß. Die Tibeter etwa
säumen ihre Kleider mit vielfärbigen Streifen, wobei
rot mit grün und schwarz mit weiß effektvoll kontrastiert
wird. Im Norden sind die Gewänder eher dunkler und haben
schlichtere Dessins.
Batiken und Stickereien
Das Batiken ist in China bereits uralt und
erzielt Effekte, die von keiner Maschine nachgeahmt werden
können. Mit einem speziellen Messer aus Messing oder
Bambus wird auf ein Stück Stoff geschmolzenes Wachs aufgetragen.
Beliebte Muster sind menschliche Figuren, Tiere und Blumen.
Wenn das Wachs hart geworden ist, wird der Stoff eingefärbt.
Ursprünglich wurde dafür nur selbst hergestelltes Indigo verwendet,
heute sind auch andere Farben – Braun, Rot, Gelb und Grün
– gängig. Um das Wachs zu entfernen, wird der Stoff gekocht.
Bei mehrfarbigen Dessins muss der Prozess entsprechend oft
wiederholt werden. Die Buyi, Miao und Mulao in Südchina sind
für ihre schönen Batikkreationen zurecht berühmt.
Stickereien und Kreuzstich sind bei den
Minderheiten gleichfalls sehr beliebt. Die bestickten Kappen
der Uiguren etwa sind ein feines Beispiel kunsthandwerklicher
Fertigkeit. Auch die Mongolen verzieren ihre Mützen, Ohrwärmer
und Vorhänge mit Stickereien. Mongolische Mädchen
schenken ihrem Liebsten zur Verlobung gewöhnlich eine
prächtig bestickte Tasche. Im Süden bringen die Miao-Frauen
an Ärmeln, Kragen, Schürzen und Röcken kunstvolle
Verzierungen an. Das Hochzeitskleid eines Miao-Mädchens
ist ein Kunstwerk für sich, an dem die künftige Trägerin
zu arbeiten beginnt, sobald sie die Technik des Stickens gut
genug beherrscht.
Bei den Li, Gaoshan, Tadschiken, Hezhe,
Naxi und Hani verzieren wunderschöne Stickereien und
Kreuzsticharbeiten die Halstücher, Blusen, Ärmelaufschläge,
Gürteln, Schürzen, Röcke und Hosenstulpen der Frauen.
Jade, Gold und Silber
Der Schmuck der nationalen Minderheiten
ist für seine Schönheit berühmt. Sehr attraktiv sind
etwa die Haarspangen, Zierkämme und Halsketten der Miao-Frauen.
Die Tibeter verarbeiten Gold, Silber, Jade und Perlen zu prächtigem
Schmuck. Silberschalen, bis zu einem Kilogramm schwer, werden
gelegentlich am Gürtel getragen. Früher wurde das Vermögen
oft in Schmuck angelegt, der ständig mitgeführt wurde.
Die Yao lieben besonders Zierrat aus Silber, denn dieses Metall
symbolisiert für sie Lichtheit und Edelmut.
Die Taiya im Norden von Taiwan verfertigen
aus Perlenschnüren sogar ganze Gewänder, für die pro
Stück bis zu 60 000 Perlen benötig werden. Sie sind nicht
nur von großem künstlerischen Wert, sondern dienen bei
diesem Volk auch als Zahlungsmittel.
Unter
der Regierungspolitik der nationalen Einheit und Gleichheit
haben die nationalen Minoritäten in der Wirtschaft und
anderen Aspekten des Lebens große Fortschritte gemacht.
Ihre traditionellen Trachten sind ein bedeutender Teil von
Chinas künstlerischem Erbe. Ihre Produktion ist heute viel
leichter und durch die Einführug von Kunstfasern noch viefältiger
geworden.
Aus
„China im Aufbau“, Nr. 9, 1983