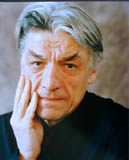
Zwischen
Illusion und Desillusion
Praktische
Erfahrungen aus zwanzig Jahren Chinesisch-Unterricht
Von
Wolfgang Kubin
Wünschen lässt sich viel. In
jungen Jahren neigt man dazu, sich für unvergleichlich zu halten,
weil man meint, die Welt als Spielwiese kommender Entfaltungsmöglichkeiten
betrachten zu können. Das Alter hat da wenig Chancen, es
wird nach dem abgetan, was ihm an Möglichkeiten nicht mehr
offensteht. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Jugend
zum Alter wird und sich die Frage gefallen lassen muss, was
denn aus den großen Projekten von einst geworden sei.
Auch ich hatte in meiner Jugend viele Träume
und lebte in einer Zeit, die von einem Traum zum anderen jagte.
Niemand stellte sich die Frage, was wünschenswert und was machbar
sein sollte. Wir wollen alles, war der Slogan, und zwar sofort.
Dies betraf auch den Chinesisch-Unterricht. Und damit bin ich
beim Thema. Aus der revolutionären Vergangenheit der sinologischen
Seminare haben wir heute nicht mehr viel geerbt. Und das ist
gut so. Nur ein Problem scheint verblieben zu sein. Dieses kleidet
sich in die alte Frage, ob es denn nicht doch möglich sein
sollte, die chinesische Sprache schnell und effektiv zu erlernen.
Am besten wie ein Chinese.
Ich möchte hier gleich meine Antwort
geben: Das ist nicht möglich. Und ich füge hinzu, das ist
auch gut so. Wenn wir nämlich Chinesisch wie die Chinesen
erlernen könnten, würden die Chinesen überflüssig. Umgekehrt
würden wir unnötig, wenn es ihnen, den Chinesen nämlich,
gelänge, Deutsch wie die Angehörigen deutschsprachiger
Länder zu beherrschen. Wir leben von den Differenzen. Und
so freue ich mich, wenn mir in Briefen bekannter chinesischer
Germanisten Verstöße gegen die deutsche Sprache auffallen.
Bitte, nicht aus Schadenfreude, sondern aus dem einfachen Grund,
dass mir die Fehler eines anderen die Freiheit geben, selber
Fehler machen zu dürfen. Perfektion macht krank. Ich möchte
das Recht auf Fehler haben. Daher möchte ich Chinesisch
nie perfekt beherrschen. Doch bis zu diesem Einverständnis
liegt ein langer Weg. Über diesen langen Weg möchte
ich Ihnen berichten.
Auf diesem Weg begegnen Sie mir und schließlich
auch meinen Studenten. Ich bitte, mit mir beginnen zu dürfen,
es ist leichter über sich als über andere kritisch zu reden.
Dabei verfolge ich zwei Ziele: Ich möchte Sie zu eben diesem
langen Weg ermuntern und Ihnen dadurch nahelegen, das Missverhältnis
von Machbarem und Wünschbarem akzeptieren zu wollen. Es ist
dies übrigens ein Missverhältnis, für dessen psychologische
Bewältigung die Dozenten oder Hochschullehrer der Sinologie
selten eine Hilfe sind. Sie leiden nämlich auch an diesem
Missverhältnis, wagen jedoch nicht, dieses zuzugeben, aus
Angst, sich vor ihren Schülern bloßzustellen. Stattdessen
tun sie so, als seien sie in allen Sprachformen des Chinesischen
daheim, ob alt oder modern. Erling von Mende, Professor für
Sinologie an der FU Berlin, hat mich einmal als Scharlatan bezeichnet.
Er hatte damit sicherlich recht, doch denke ich, nicht nur ich
bin ein Scharlatan, alle Sinologen sind Scharlatane, weil sie
in eine Rolle gezwungen werden, der sie nicht gerecht werden
können, der Rolle des Sprachartisten und Wissensgiganten.
Ich habe spät erst mit dem Chinesischen
begonnen und lange gebraucht, eine gewisse Sicherheit zu finden,
die Sicherheit, die mir heute erlaubt, meine Mängel öffentlich
einzugestehen. Das Chinesische ist nämlich so uferlos wie
China selbst, wir werden in unseren Fähigkeiten und Erkenntnissen
nie an ein Ende gelangen. Und lassen Sie mich hinzufügen, es
ist gut so, denn ich will weder alles können noch alles
wissen. Ich bin dankbar für alles, was größer ist
als ich selbst. In etwa 25 Jahren Beschäftigung mit dem
Chinesischen habe ich zunächst gelernt, dass das Studium
der chinesischen Sprache ebenso wie die Beschäftigung mit
der Sinologie ein lebenslanger Prozess ist. Ein Prozess wohlgemerkt,
das heißt, man wird zwar stets seine Fähigkeiten
verbessern, aber nie an ein Ende kommen. Dies ist die Dimension
der Zeit, welche Schüler und Lehrer viel zu wenig beachten.
In welchem Prozessabschnitt befinde ich mich
heute? Durch die Arbeitssituation bedingt habe ich bis jüngst
das moderne Chinesisch in den Vordergrund und das klassische
Chinesisch in den Hintergrund treten lassen müssen. Dabei habe
ich die eine Fähigkeit zu Ungunsten der anderen entwickeln
müssen. Daher bin ich, was das Klassische angeht, nur in meiner
Domäne, der Dichtkunst nämlich, zu Hause. Aber auch
hier freue ich mich über jede Übersetzung, selbst wenn
diese nur in die chinesische Hochsprache erfolgt ist. Am glücklichsten
machen mich japanische Übertragungen, weil sie, für das
Auge leicht erfaßbar, die Grammatik aufschlüsseln. Für
das moderne Chinesisch bedarf ich einer solchen Hilfe nicht,
aber das ist nicht ganz selbstverständlich, denn nach einem
Jahr Peking hatte ich mich 1975 in Japan noch fleißig
mit Übersetzungen moderner chinesischer Literatur ins Japanische
eingedeckt. Denn die moderne chinesische Hochsprache habe ich
eigentlich erst sehr lange nach meinem Studium in Bochum und
Peking und nach meiner Weiterbildung in Berlin erlernt, nämlich
erst in Bonn, als ich dort Professor für Chinesisch wurde. Hier
kamen zwei glückliche Umstände zusammen, übereifrige, wissbegierige,
begeisterungsfähige Studenten und engagierte Chinesen,
sei es in der Gestalt von Lektoren oder in der Gestalt meiner
Frau.
Es gibt Tage in Bonn, da spreche ich nicht
ein Wort Deutsch, und dennoch belächeln meine beiden Söhne
mein Chinesisch. Sie kritisieren meine Töne, mein geringes
aktives Vokabular und den oft fehlenden präzisen Ausdruck.
Aber was habe ich denn dann in diesem Treibhaus des Chinesischen
überhaupt gelernt? Mit den Augen kann ich fast alles lesen,
mit den Ohren fast alles verstehen. Meine Schwäche jedoch
liegt im sprachlichen und schriftlichen Ausdruck. Ich denke
zu deutsch und bin nur bei überwachem Zustand in der Lage, mich
vom Fluss der Sprache leiten zu lassen. Und nur wenn ich innerlich
ausgeglichen, ja selbstbewusst bin, traue ich mir eine Dolmetschertätigkeit
zu, aber auch da, unvorbereitet nur im Bereich der Kultur. Alles
andere bedürfte einer gezielten Vorbereitung.
Ich betone den psychischen Faktor hier so
sehr, weil Verstehen und Sprechen oft auch etwas mit der Seele
des einzelnen zu tun hat. Man darf nämlich im Akt der Übertragung
nicht an dem zu zweifeln beginnen, was man eindeutig verstanden
hat. Und das Schreiben? Es ist eine Qual. Ich habe nämlich
eine Rechtschreibschwäche. Es hat sich als unheilvoll erwiesen,
das klassische und moderne Chinesisch gleichzeitig mit dem modernen
Japanisch zu erlernen. Mir gehen heute immer noch die unterschiedlichen
Kürzel durcheinander, so dass ich mich beim Schreiben wieder
und wieder durch die Benutzung des Xinhua Zidian der
richtigen Zeichen versichern muss. Es ist da wenig Trost, dass
mir chinesische Dichter nicht selten ihre selbstgesetzten Manuskripte
mit Verschreibungen in die Hand drücken. Mit anderen übe ich
gern Nachsicht, mit mir nie.
Wieviel ich in den nächsten 15 Jahren
bis zu meiner Pensionierung noch lernen werde, weiß ich
nicht. Ich kann nur von meinem Ehrgeiz sprechen, nämlich
einmal, was die moderne Hochsprache angeht, mein Niveau in Schrift
und Wort anzuheben, und zum anderen, was das Klassische betrifft,
meine Lesefähigkeit von japanischen und chinesischen Hilfestellungen
befreien helfen. Letzten Endes werde ich selbst am Tag meiner
Emeritierung das Chinesische nicht so erlernt haben, wie ich
es mir gern wünschen würde. Diese Erkenntnis hat mehrfache Auswirkungen:
auf mich selbst und auf meine Studenten. Und damit komme ich
zu den Wegen des Chinesischerwerbs. Ich war nie ein guter Student
und suchte sehr bald meine Zuflucht im Auswendiglernen von Texten.
So hatte ich Latein, Griechisch, Englisch und Französisch
gelernt. Ich sehe das Auswendiglernen heute nach wie vor als
die einzige Möglichkeit an, der Unlogik chinesischer Grammatik
Herr zu werden und sich einen chinesischen Sprachfluss anzueignen.
Wie Sie wissen, ist dies eine konfuzianische
Methode. Sie wurde uns auch in Bochum von Alfred Hoffmann nahegelegt,
und sie funktionierte. Dies ist ein Grund, warum ich von Studenten
heute eigentlich nur eines erwarte, Fleiß und Hingabe.
Sind diese gegeben, kommt alles andere von selbst, besonders
wenn man wie ich Spätentwickler ist.
Bis zu meiner Begegnung mit Alfred Hoffmann
habe ich wie viele andere auch mit dem Chinesischen im Hader
gelegen. Ich war von Münster gleichsam geflohen, da ich mit
dem dort Erworbenen nicht umgehen konnten. Wir waren jedoch
ebenso in Bochum mit denselben unlösbaren Problemen konfrontiert
wie die heutigen Studierenden des Chinesischen auch. Keine Methode
schien uns recht, kein Lehrbuch das richtige zu sein. Die Dozenten
konnten machen, was sie wollten, wir hielten unsere Kritik stets
für gerechtfertigt, weil wir schließlich frustriert waren
und trotzdem etwas lernen wollten. Die damalige Kritik an allem
führte zu den absonderlichsten Experimenten, die einen schworen
auf die Lehrwerke aus der VR China, die anderen auf die entsprechenden
Werke aus den USA, die einen zogen ins Sprachlabor, die anderen
ließen sich die Fibeln für Erstklässler aus Taiwan
kommen. Ich will nicht sagen, niemand habe etwas gelernt, aber
da alles damals eine Frage von Revolution und Reaktion war,
lag die Erfolgsquote sicherlich sehr viel niedriger als heute.
Berlin 1977 stellte dann ein noch größeres
Experimentierfeld dar, auch aus Gründen, die mit dem Studiengegenstand
nichts mehr zu tun hatten. Um der Arbeitsklasse willen wurde
der Sprachunterricht nämlich auf morgens 8 Uhr anberaumt,
so dass ich als notorischer Frühaufsteher sehr bald der einzige
pünktliche Arbeiter war. Viel Chinesisch habe ich damals nicht
vermitteln und auch nicht lernen können. Trotzdem war Berlin
keine verlorene Zeit, da die Fortsetzung der Irrtümer mir für
Bonn einen pragmatischen Weg zwingend erscheinen ließ.
Bis in die Nachwehen des 4. Juni 1989 hinein ging dieser neue
Weg auf.
Ich hatte jedoch in Bonn mehrfaches Glück.
Die Zeit der Richtungskämpfe war vorbei. Es war eine Selbstverständlichkeit,
dass die pädagogisch gut aufbereiteten Lehrbücher des einstigen
Pekinger Spracheninstitutes, der heutigen Hochschule für die
Sprache und Kultur Chinas, benutzt wurden, Lehrwerke, die ich
mir in stets neuester Ausgabe schicken ließ. Das betraf
insbesondere die Handbücher zur Zeitungslektüre. Mein zweites
Glück in Bonn war, auf gute Studenten zu treffen, so gute, dass
ich selbst mit meinen Chinesischkenntnissen oft gefordert war.
Die allgemeine Begeisterung und der ungezügelte Lerneifer trieben
die Studenten nicht nur dicht vors Katheder, sondern auch in
ein gesundes Konkurrenzverhalten zu- und miteinander. Es gab
immer welche, die über Gebühr vorbereitet waren und sich von
der Fülle des Stoffes nicht erschöpfen ließen. So
wurden neue Kurse und Kursformen nicht als Zwang, sondern als
Glück empfunden, im Grund- wie im Hauptstudium. Ich selbst sah
mich oft genötigt, das Doppelte meines Lehrdeputats zu
unterrichten, um die Studierenden zufrieden zu stellen. Die
neuen Kurse betrafen hauptsächlich das Hauptstudium. Im
Grundstudium ließ sich auf Grund der Angebotsdichte in
Sachen Sprache lediglich ein praktischer Kurs zur Zeitungslektüre
einrichten, in welchem man die bereits erarbeiteten Lektionen
umgekehrt abfragte, das heißt, ich fragte wie in der Vorbereitung
auf einen Dolmetscherkurs die für die politische und Wirtschaftssprache
wichtigen Satzmuster auf Deutsch ab.
Die Veränderungen im Hauptstudium sahen
einen Videokurs, Konversationskurse zu Themen aus den Bereichen
Politik, Wirtschaft und Kultur sowie eine Vorlesung auf chinesisch
vor. Für die Examenskandidaten wurden eigens schriftliche wie
mündliche Kurse zur Vorbereitung auf Examen eingerichtet. Man
konnte also unter examensähnlichen Bedingungen dreistündige
Übersetzungsklausuren Chinesisch-Deutsch, Deutsch-Chinesisch
in den jeweiligen Fachsprachen bzw. Aufsätze nach Wahl
schreiben. Da die mündliche Fachprüfung im Examen nur auf Chinesisch
erfolgte und mit einer Stegreifübersetzung begann, wurden eigens
Kurse für den fachsprachlichen Selbstausdruck und für die unvorbereitete
Übersetzung eingerichtet.
Die Leistungen im Examen waren im Großen
und Ganzen vorzeigbar, doch was man nicht vergessen darf: sie
waren durch einen monatelangen Drill vorbereitet, sie waren
das Ergebnis aus studentischem Fleiß und lehrerseitigem
Ehrgeiz. Für einen Übersetzer bzw. Dolmetscher ist Drill
unabdingbar, auch für die Herausbildung eines Selbstbewußtseins.
Viele Studierende der Sinologie bzw. des Faches Chinesisch leiden
an Unterschätzung oder gar an Minderwertigkeitsgefühlen.
Ein guter Lehrer erkennt dies und versucht es im Unterricht
auch durch Drill abzubauen. Er wird dann in der Lage sein, seine
Schüler in einen Beruf zu entlassen.
Doch es ist nun an der Zeit, besser in der
Vergangenheit zu reden. Seit wenigen Jahren höre ich nämlich
von Abgängern meist Klagen, sie fänden keine Arbeit,
sie seien durch die Universität nicht auf das Berufsleben
vorbereitet worden usw. Die Klagen sind nicht ganz unberechtigt,
doch meist versuche ich mich, ihrer zu erwehren. Warum? Nach
1989 und nicht nur nach dem 4. Juni 1989 ist eine ganz andere
Studentengeneration auf den Plan getreten. Alle Hochschullehrer,
ganz gleich in welchem Fach, bedauern das wachsende Desinteresse
der Studierenden in Hörsaal und Sprechstunde. Der Grund
ist ganz einfach.
Alles ist im Wandel begriffen, und niemand
kann mehr mit Sicherheit sagen, er wird einmals als Lehrer,
als Arzt, als Jurist oder als Sinologe arbeiten. Die Universität
kann nicht auf einen Beruf vorbereiten, sondern nur Optionen
anbieten. Die eigentliche Bildung beginnt erst nach dem Examen.
Dies setzt aber voraus, dass jemand weiß, was er will.
Viele wissen aber selbst nach dem Examen nicht einmal, was sie
eigentlich mit ihrem Leben anfangen wollen. Es ist nicht meine
Aufgabe, dies hier zu vertiefen. Ich möchte auf mein Thema
zurückkommen. Die Ausbildungssituation in der Sinologie bzw.
im Fach Chinesisch war nie so gut wie heute: kleine Klassen,
relativ viele Lehrer, leere Seminarbibliotheken. Und dennoch
sind die Leistungen viel schlechter als früher, inzwischen schleppt
man Studenten mit, die in der Vergangenheit angesichts der strebsamen
Kommilitionen das Weite gesucht hätten. Mancher Kurs wird
vorzeitig beendet, weil niemand mehr hinreichend vorbereitet
ist, manch ein Kurs wird gar abgesagt, weil niemand mehr das
notwendige Niveau hat.
Heute kann man nur noch sagen, wer kein Chinesisch
lernt, ob modern oder klassisch, ist selber schuld. Es sind
nicht die unperfekten Lehrbücher, es sind nicht die überarbeiteten
Dozenten, es sind nicht die Massen-Universitäten, die das
Erreichen selbstgesteckter Ziele nicht möglich machen,
es sind die Studenten selbst, die, weil sie keine Träume
und keine Forderungen mehr haben, in der Uferlosigkeit des Chinesischen
versinken.
Wer weiß, was er will, steht morgens
um 6 Uhr auf und lernt jeden Morgen eine Stunde lang sein Lehrbuch
oder seinen Lieblingsklassiker auswendig. Er hört dann
irgendwann auf, deutsch zu denken und deutsche Satzmuster im
Chinesischen zu bilden. Ihm gehen dann die chinesischen Sätze
so mühelos über die Lippen wie meinen beiden Jüngsten, wenn
sie in dieser Jahreszeit sagen: „Bu dai shoutao leng.“ Auf deutsch
würden wir sagen: Wenn man keine Handschuhe trägt, ist
einem kalt. Wie umständlich. Ohne Handschuhe ist einem
kalt. Immer noch umständlich. Und wer wäre nicht geneigt,
ins Chinesische übertragend so zu sprechen: „Ruguo ni bu dai
shoutao, ni hui juede feichang leng.“ Nur: wer spricht so, das
ist Buchchinesisch, gesprochen von jemandem, der deutsch denkt.
Die Kunst des Chinesischen liegt in der Aufgabe des Deutschen,
und diese Kunst erwirbt man nur durch jahrelanges Auswendiglernen.
Jahrelanges Auswediglernen bedeutet aber auch
jahrelange Geduld mit sich und anderen. Es ist dies eine gute
Schule auch für den Beruf. Man muss nicht nur auf die Beherrschung
des Chinesischen warten können, sondern auch auf den Beruf.
Viele Studierende macht diese meine Aussage aggressiv, und ich
bin dafür schon viel beschimpft worden. Es weiß nur niemand,
dass es zu meiner Zeit oftmals noch nicht mal die Chance zu
einer Bewerbung gab, und: dass ich nie Professor werden wollte.
Ende der 70er Jahre habe ich mich zwei- oder dreimal bewerben
können. Einmal hatte ich Glück. In den 80er Jahren konnte
ich mich etwa sechsmal bewerben. Hier hatte ich wieder einmal
Glück. Hätte ich die beiden Male dies Glück nicht gehabt,
wäre ich heute Reiseleiter für Asien oder Lehrer für Deutsch
und Religion. Mein österreichisches Lebensprinzip „Wurschteln“
hat mich für etwas anderes ausersehen. Aber die anderen beiden
Berufe hätten mir sicherlich ebensoviel Spaß gemacht.
Wenn ich heute manchmal auf Grund von Anfragen
in die Situation komme, meinen Examenstudenten Arbeit zu vermitteln,
treffe ich oft auf ein Zögern: Dem einen ist es zu wenig
Geld, der anderen nicht bequem genug. Mann und Frau geben sich
nicht selten wählerisch, was ich in meiner Jugend gern
hätte sein wollen oder mögen.
Inzwischen scheinen mir auch aus anderem Anlaß
die Klagen der arbeitslosen Sinologen etwas Irreales angenommen
zu haben. Jeden Winter beginnen in Deutschland 20 000 Menschen
Germanistik zu studieren. In Bonn sind 4000, in München oder
Berlin gar 5–8000 Studenten für dieses Fach eingeschrieben,
in ganz Deutschland gar 100 000. Aber einen Arbeitskräftebedarf
auf dem Arbeitsmarkt, wie es so schön heißt, gibt
es für sie nicht. Doch warum studieren dann so viele Menschen
Germanistik? Weil Germanistik ein großartiges Fach ist?
Ich weiß es nicht.
Worauf will ich hinaus? Manchmal tut man Dinge,
die sich nicht erklären lassen. Wichtig ist nur, dass man
sie gut tut, denn gute Leute gibt es nur sehr selten. Die Zukunft
lässt sich nicht schematisch festlegen, daher ist „Wurschteln“
kein schlechtes Prinzip. Wege mögen sich dabei von selbst
ergeben. Das mag fromm klingen, aber es ist die Erfahrung meines
Lebens. Und das möchte ich nicht deswegen Lügen strafen,
weil ich fürchten muss, von Ihnen der Weltfremdheit geziehen
zu werden.
Ich möchte mit einem Bild schließen,
über das ich Sie nachzudenken bitte: Als ich im September zu
einer Konferenz nach Peking flog, traf ich auf dem Flughafen
Frankfurt einen ehemaligen Schüler. Er bestieg die erste Klasse,
ich die Touristenklasse. Selbst Business-Klasse steht bei Einladungen
für mich und meinesgleichen nicht einmal zur Debatte. Später
erfuhr ich, dass dieser promovierte Sinologiestudent von einst
immer nur erster Klasse fliege, er sei schließlich der
Generalvertreter einer großen deutschen Autofirma für
ganz China. In seiner Pekinger Garage ständen ein Jaguar
und drei schwere Motorräder. Doch er verstünde seinen Reichtum
nicht zu genießen, ihm sei das Leben fad.
Mit diesem Bild möchte ich
Ihnen manches sagen. Erfolge mit Chinesisch sind möglich,
aber sie bedürfen vieler Dinge: der Zeit, des Fleißes,
der Geduld, und: man muss den großen Erfolgen auch gewachsen
sein. Kleine und kleinere Erfolge, um die es Ihnen und mir sicherlich
eher geht, haben daher vielleicht auch ihren Wert. Ihre Mitkonkurrenten
gehen nicht in die 100 000, eigentlich haben Sie derzeit nur
einen einzigen Mitbewerber: sich selbst.
Wolfgang
Kubin, geb. 1945. 1973 Promotion an der Ruhr-Universität
Bochum, 1981 Habilitation an der FU Berlin. Seit 1985 Professer
für Chinesisch an der Universität Bonn und seit 1989 für
Sinologie.
(Orientierungen
1/1999)

