Jun-Porzellan
–
Einmalig und zauberhaft
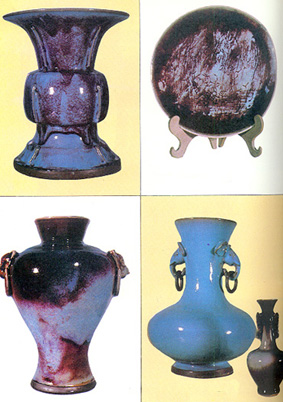
Ist die
Rede vom Jun-Porzellan, erinnert man sich gern an die Sage
von einer Porzellanbrennerin aus der Song-Zeit (960–1279).
Ein buntfarbiges und kristallhelles Weingefäß wurde von ihr
hergestellt und als ein Tributgeschenk an den Kaiser gesandt.
Es war so faszinierend, dass der Kaiser sich an dieser Rarität
berauschte und von ihr verlangte, ein gleiches wie dieses
zu brennen. Die Frau versuchte eins ums andere Mal, das gewünschte
Weingefäß zu brennen, was ihr jedoch bis zum Ablaufen der
ihr gesetzten Frist nicht glückte. Deshalb blieb ihr nichts
anderes übrig, als Selbstmord zu begehen, und so sprang sie
in ihren Brennofen. Als man die sich gleichzeitig in diesem
Ofen befindenen Porzellanprodukte ausräumte, blendete daraus
völlig unerwartet ein wunderschönes Weingefäß hervor, das
noch viel schöner war als das erste. Später erklärte man dieses
Wunder damit, dass die Porzellanbrennerin Kupferschmuck an
ihrem Körper getragen und dieser eine entscheidende Rolle
beim Brennvorgang gespielt habe. Auf Grund dieser Beobachtung
entwickelte man ein Brennverfahren, bei dem der Glasur eine
bestimmte Menge an Kupferoxyd zugegeben wurde und beim Brennen
eine entsprechende Temperaturveränderung erfolgte.
Vielfarbig
Die Kleinstadt
Shenhou im Kreis Yu, Provinz Henan in Mittelchina, ist die
Hochburg des Jun-Porzellans. Schon in der Song-Zeit wurde
hier Jun-Porzellan gebrannt. Es besticht durch Schlichtheit
und Lebendigkeit, Natürlichkeit und Vornehmheit. Die meisten
Jun-Porzellanwaren wirken Trauben-, Auberginen-, Flieder-
und Rosa-Purpur; beim Grün Smaragd-, Papageien-, Rosa- und
Pflaumen-Grün; außerdem gibt es Blau und Fischbauch-Weiß.
Insgesamt weist das Jun-Porzellan 5000 verschiedene Farbschattierungen
auf.
Einmalig
Auf der
ganzen Welt ist kein Paar Jun-Porzellan zu finden, dessen
Farben gleich sind. Auch wenn das Prozellan mit der gleichen
Glasur überzogen und gleichzeitig im selben Ofen gebrannt
wird, kommen die Farben auf jedem Teil ganz unterschiedlich
heraus. Deshalb sagt man seit jeher: „Beim Einsetzen in den
Brennofen ist ungebranntes Porzellan gleichfarbig, beim Herausnehmen
aber ist es buntfarbig“. Selbst ein erfahrener Porzellanbrenner
ist nicht in der Lage, die Farben seiner Produkte vorherzusehen.
Zauberhaft
Manche
Jun-Porzellanartikel sind kristallklar und -hell, manche sehen
aus wie weißer Nephrit, andere sind kontrastreich und ihre
Farben verändern sich mit unterschiedlicher Lichteinwirkung.
Selten und kostbar sind diejenigen, deren Glasur mit Linien
und Flecken verziert ist, sichtbar, aber spiegelglatt. Die
Linien erscheinen hauptsächlich in der Form von Rinderhaaren,
Eisrissen und Krebstatzen sowie ähnlichen feinen Linien. Die
Flecken sind im Wesentlichen moos- und perlenartig. Porzellan
mit farbig gefleckter Glasur zählt zum besten. Linien und
Flecken entstehen durch Verlaufen der Glasur beim Brennvorgang.
Wunderschön wirken die in der Glasur natürlich entstandenen
Landschaften: Berge und Flüsse, Pavillons und Terrassen, Häuser
und Wasserfälle sowie steile Felsen. Sie formen sich zu pastoralen
Szenen, wie es virtuosen Malern nur schwerlich gelingt. Jun-Porzellanwaren
machen auf den Betrachter immer einen tiefen Eindruck und
entführen ihn in eine sagenhafte Welt. Eben das ist die Ursache,
warum chinesische und ausländische Sammler nicht mehr von
Jun-Porzellan lassen wollen, wenn sie erst einmal die Sammelleidenschaft
gepackt hat.
Selten
und gut
Zwei
chinesische Redewendungen veranschaulichen den hohen Wert
des Jun-Porzellans: „Man besitzt lieber ein Stück Jun-Porzellan
als Reichtum“, und „Gold ist schätzbar, Jun-Porzellan unschätzbar“.
Denn neben seinem hohen Kunstwert kommt ein Jun-Porzellanartikel
kaum noch einmal auf der Welt vor. Zudem kann Jun-Porzellan
nur sehr schwer auf Bestellung hergestellt werden.
Während
der Song-Zeit erlebte Jun-Porzellan eine starke Entwicklung,
obwohl es bereits in der Tang-Zeit (618–907) entstanden war,
wobei es auch in der Song-Zeit nur am kaiserlichen Hof benutzt
werden durfte, und privater Besitz damals für gesetzwidrig
gehalten wurde. Während der Herrschaft des Song-Kaisers Hui
Zong (Anfang des 12. Jahrhunderts) stand das Jun-Porzellan
in seiner höchsten Blüte. Danach wurde die Herstellung des
Jun-Porzellans für immer eingestellt. Seitdem geriet das Herstellungsverfahren
in Vergessenheit. Deshalb war song-zeitliches Jun-Porzellan
zu einer unschätzbaren Rarität geworden.
Alte
Kunst, neues Leben
Ab 1955
organisierte die Volksregierung erfahrene Porzellanbrenner
und entsprechende Forschungsinstitutionen, um verlorene Glasurrezepte
und Brenntechnologien neu zu entdecken bzw. zu entwickeln.
Nach siebenjährigen Bemühungen gelang es ihnen schließlich,
ein Verfahren für die Herstellung von Jun-Porzellan zu entwickeln,
nachdem über hundert verschiedene Experimente angestellt worden
waren.
Der wichtigste
Punkt bei der Herstellung von Jun-Porzellan ist der Brennvorgang.
Dabei kommt es auf die Bedingungen im Brennofen, wie z. B.
Rohmaterialien, Brennstoff, Glasur, Temperatur und die Lage
des Brennofens, an. Äußere Bedingungen, wie etwa Jahreszeit,
Umgebungstemperatur, Regen und Wind, beeinflussen ebenfalls
direkt die Qualität des Jun-Porzellans. All diese Faktoren
wirken während des ganzen Brennprozesses zu jeder Sekunde.
Die Erfolgsrate eines Brandes liegt normalerweise bei nur
30%. Nicht selten kommt es vor, dass ein ganzer Brand nicht
zu gebrauchen ist. Deshalb pflegt man auch zu sagen: „Auf
einen gelungenen Brand kommen neun misslungene Brände.“ Das
Wort „gelungen“ bedeutet hier, dass die Farbe „Rot“ beim brennen
zum Vorschein kommt. Das Rezept der Rot-Glasur und dessen
Prozesskontrolle entscheiden die Qualität des Jun-Porzellans.
Es ist noch schwer realisierbar, eine prächtig glasierte Rarität
zu brennen.
Ein Beispiel
dafür ist das Erlebnis von Lu Zhengxing, einem Veteran in
der Jun-Porzellan-Herstellung. In seinem 50-jährigen Arbeitsleben
ist es ihm nur einmal gelungen, eine Vase mit Goldflecken
anzufertigen. Auf ihrem flammengrünen Hintergrund erschienen
neun blattförmige, gleichmäßige Goldflecken. Er erzählte:
„Meine Familie beschäftigt sich seit einigen Generationen
mit der Porzellanbrennerei. Nur mein Großvater hatte von einer
ähnlichen Vase wie meiner gehört, aber niemals gesehen.“
In der
Ausstellungshalle der Kunstgewerblichen Fabrik von Shenhou
sind drei seltene Kunstwerke zu sehen: der Schmuckteller „Wegen
der Kälte kehrt die Krähe ins Nest zurück“, die Flasche „Grüne
Berge im Wolkenmeer“ und die Vase in Form eines Gänsehalses
„Regenwürmer hinterlassen schlängelnde Spuren auf der Erde“.
In dreißig Jahren seit ihrer Gründung hat die Fabrik nur diese
drei seltenen Kunstwerke hergestellt. Direktor Ma meinte:
„ Wenn man auch tausend Porzellan-Serien brennt, so gelingt
einem eine Rarität nur selten.“
Zur Zeit
arbeiten 10 000 Bewohner der Kleinstadt Shenhou – ein Viertel
aller Einwohner – in der Produktion und der wissenschaftlichen
Forschung dieser Porzellanbranche, und sie haben durch ihre
Bemühungen die Anzahl der gelungenen Produkte beträchtlich
erhöht. Die Annahme, dass Artikel aus Jun-Porzellan nicht
höher als 33,3 cm sein könnten, ist wiederlegt worden.150
cm und 200 cm große Schmuckvasen und ein großer Blumentopf
mit einem Durchmesser von 100 cm sind hergestellt worden.
Alte Gussverfahren sind verbessert worden, so dass die Qualität
und Produktion der Prozellanmasse beachtlich stieg. Überdies
macht die Formung große Fortschritte. Man ist jetzt dazu in
der Lage, einen am Henkel hängenden nahtlosen Ring erfolgreich
zu brennen, was in der Vergangenheit unvorstellbar war. Dadurch
kann Jun-Porzellan noch schöner gestaltet und sein Wert noch
gestiegert werden. Die verschiedenen Arten von Jun-Porzellan
sind von knapp dreißig in der Song-Zeit auf tausend angewachsen.
Manch seltene Glasur ist entwickelt worden, und in- und ausländische
Sachverständige sind sich einig darüber, dass die neuentwickelten
Jun-Porzellanartikel die song-zeitliche Tradition allseitig
fortgesetzt und weiterentwickelt haben.
Produkte
aus Jun-Porzellan werden heute in über fünfzig Ländern verkauft.
In China nennt man es „Schatzporzellan“, und es dient heute
als Ehrengeschenk der Regierung.
Aus „China im Aufbau“, Nr.
12. 1984

