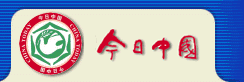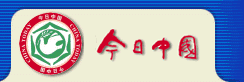|
Das
Ehegesetz – ein Barometer der sozialen Wandlungen
 Bereits
kurz nach Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 wurde ein
Ehegesetz erlassen. Es hatte das Ziel, die Frauen aus dem feudalistischen
Ehesystem zu befreien. 1980, kurz nach Ende der Kulturrevolution,
wurde dann das zweite Ehegesetz der Volksrepublik verabschiedet.
Es sollte nach dem 10 Jahre andauernden Chaos der Kulturrevolution
erneut die Gesetzesordnung herstellen. Im Jahr 2000, zwanzig Jahre
nach Einführung der Reform- und Öffnungspolitik, wurde schließlich
mit einer Revision des Ehegesetzes begonnen. Man könnte das
Ehegesetz also zu recht als eine Art Barometer der sozialen Veränderungen
in China bezeichnen. Bereits
kurz nach Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 wurde ein
Ehegesetz erlassen. Es hatte das Ziel, die Frauen aus dem feudalistischen
Ehesystem zu befreien. 1980, kurz nach Ende der Kulturrevolution,
wurde dann das zweite Ehegesetz der Volksrepublik verabschiedet.
Es sollte nach dem 10 Jahre andauernden Chaos der Kulturrevolution
erneut die Gesetzesordnung herstellen. Im Jahr 2000, zwanzig Jahre
nach Einführung der Reform- und Öffnungspolitik, wurde schließlich
mit einer Revision des Ehegesetzes begonnen. Man könnte das
Ehegesetz also zu recht als eine Art Barometer der sozialen Veränderungen
in China bezeichnen.
Das erste Ehegesetz für
die Befreiung der Frauen
 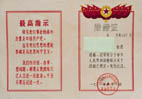 Was
die Vorstellungen von Ehe und Familie vor 1949 in China angeht,
so sind sie relativ wahrheitsgetreu in dem Film „Die rote Laterne“
von Zhang Yimou dargestellt. Wer wen heiratete, entschieden die
Eltern und oft genug auch einfach das Geld. Wenn ein Mann Geld hatte,
konnte er ein paar Frauen haben. Die Frauen hingegen hatten jeweils
nur einem Mann treu zu bleiben. Männer durften sich scheiden
lassen, Frauen nicht. Frauen hatten die drei Gehorsamspflichten
zu erfüllen (gegenüber dem Vater vor der Ehe, gegenüber dem Mann
in der Ehe und gegenüber dem Sohn nach dem Tod des Mannes) und die
vier Tugenden zu beachten (Sittsamkeit, geziemende Sprache, richtiges
Betragen und Fleiß). Ihre Füße wurden eingebunden. Und
Witwen durften nicht wieder heiraten. Mit einem Wort: Die Frauen
standen gesellschaftlich auf der untersten Stufe. Was
die Vorstellungen von Ehe und Familie vor 1949 in China angeht,
so sind sie relativ wahrheitsgetreu in dem Film „Die rote Laterne“
von Zhang Yimou dargestellt. Wer wen heiratete, entschieden die
Eltern und oft genug auch einfach das Geld. Wenn ein Mann Geld hatte,
konnte er ein paar Frauen haben. Die Frauen hingegen hatten jeweils
nur einem Mann treu zu bleiben. Männer durften sich scheiden
lassen, Frauen nicht. Frauen hatten die drei Gehorsamspflichten
zu erfüllen (gegenüber dem Vater vor der Ehe, gegenüber dem Mann
in der Ehe und gegenüber dem Sohn nach dem Tod des Mannes) und die
vier Tugenden zu beachten (Sittsamkeit, geziemende Sprache, richtiges
Betragen und Fleiß). Ihre Füße wurden eingebunden. Und
Witwen durften nicht wieder heiraten. Mit einem Wort: Die Frauen
standen gesellschaftlich auf der untersten Stufe.
Nach Gründung der Volksrepublik betrachtete die
Regierung es als eine ihrer vordringlichsten Aufgaben, ein Ehegesetz
zu erlassen, das dem neudemokratischen Ehesystem entsprach.
 So
trat am 1. Mai 1950 das erste Ehegesetz in Kraft, das acht Artikel
und 27 Paragraphen umfasste. Hauptprinzipien waren: Die Abschaffung
des feudalistischen Ehesystems, demgemäß die Ehe von
den Eltern entschieden oder erzwungen wurde, Männer ehrenwert
und Frauen minderwertig waren und die Interessen der Kinder außer
acht gelassen wurden; Einführung eines aufgeklärten Ehesystems,
in dem Freiheit der Eheschließung, Monogamie und Gleichberechtigung
von Mann und Frau verankert waren sowie die Frauen und die Interessen
der Kinder geschützt wurden; außerdem das Verbot der
Bigamie, der Verheiratung von Kindbräuten, der Einmischung
in die Ehefreiheit von Witwen und der Forderung von Geld und Vermögen
bei Eheschließungen. Die Einführung von Monogamie und Freiheit
der Eheschließung (im Gegensatz zu einer von den Eltern arrangierten
Ehe) war von großer historischen Bedeutung. Mao Zedong selbst
hob hervor, daß das Ehegesetz neben der Verfassung eines der
grundlegenden Gesetze des Staates sei. So
trat am 1. Mai 1950 das erste Ehegesetz in Kraft, das acht Artikel
und 27 Paragraphen umfasste. Hauptprinzipien waren: Die Abschaffung
des feudalistischen Ehesystems, demgemäß die Ehe von
den Eltern entschieden oder erzwungen wurde, Männer ehrenwert
und Frauen minderwertig waren und die Interessen der Kinder außer
acht gelassen wurden; Einführung eines aufgeklärten Ehesystems,
in dem Freiheit der Eheschließung, Monogamie und Gleichberechtigung
von Mann und Frau verankert waren sowie die Frauen und die Interessen
der Kinder geschützt wurden; außerdem das Verbot der
Bigamie, der Verheiratung von Kindbräuten, der Einmischung
in die Ehefreiheit von Witwen und der Forderung von Geld und Vermögen
bei Eheschließungen. Die Einführung von Monogamie und Freiheit
der Eheschließung (im Gegensatz zu einer von den Eltern arrangierten
Ehe) war von großer historischen Bedeutung. Mao Zedong selbst
hob hervor, daß das Ehegesetz neben der Verfassung eines der
grundlegenden Gesetze des Staates sei.
Das neue Ehegesetz fand bei den meisten Chinesen
großen Anklang, stieß aber auch auf hartnäckigen
Widerstand. Manche Leute waren der Meinung, das Ehegesetz sei ein
Frauengesetz, nun würden die Männer unterdrückt. Andere bezeichneten
es als „Scheidungsgesetz“. Im Mai 1950 stellte Deng Yingchao, die
damalige Vizevorsitzende des Allchinesischen Frauenverbandes, in
ihrem Bericht über das Ehegesetz fest: „54% aller Gerichtsfälle
auf dem Land in Sachen Ehe bzw. 84% in der Stadt beschäftigen
sich mit der Scheidung von Ehen bzw. der Lösung von Verlobungen.
Die zugrundeliegenden Faktoren sind in erster Linie die durch Eltern
arrangierte oder erzwungene Ehen, Kauf oder Misshandlung der Ehefrau,
Eheschließung mit Minderjährigen, Bigamie, Ehebruch und
böswilliges Verlassen. Die Kläger sind auf dem Land zu
58% Frauen, während es in der Stadt 92% sind. Die geschiedenen
Paare sind in der Mehrheit nicht älter als 35.“
In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden,
dass viele Frauen es nie bis zum Gericht schafften: Sie wurden vorher
getötet oder begingen Selbstmord. 1951 waren das über 10000
Frauen in Zentral- und Südchina.
Das zweite Ehegesetz
 Das
zweite Ehegesetz trat am 1. Januar 1981 in Kraft. Die Kulturrevolution
war seit fünf Jahren zu Ende, die Reform- und Öffnungspolitik
stand an ihrem Anfang. Damals kamen die meisten Chinesen zu der
Erkenntnis, dass die echte und solide Grundlage eines starken Staates
seine wirtschaftliche Entwicklung sei. Die in den 50er Jahren von
der Regierung befürwortete Maxime „Mehr Menschen, mehr Kraft“ hatte
in den 30 Jahren danach die uneingeschränkte Vermehrung der
Bevölkerung zur Folge, eine Entwicklung von negativer Tragweite.
Geburtenkontrolle war dringend geboten. Die Einführung der Reform-
und Öffnungspolitik führte zu einer Bewußtseinsveränderung
im Denken der Chinesen. Sie begannen, die Ehescheidung nicht länger
als eine persönliche Schande oder eine Verletzung der sozialen
Gebote zu betrachten. Sie begannen auch, dem Gefühl mehr Bedeutung
beizumessen. Das Wort von Friedrich Engels „Eine Ehe ohne Liebe
ist eine unmoralische Ehe“ machte den Scheidungsantrag noch richtiger.
Diese sozialen Veränderungen erforderten ein neues, ihnen entsprechendes
Ehegesetz. Folgende Punkte wurden darin revidiert oder ergänzt:
Zur Förderung späterer Heirat und damit späterer
Geburt wurde die Ehemündigkeit für Männer um zwei Jahre auf
22 und für Frauen auf 20 erhöht. Zwecks Geburtenkontrolle wurde
die Bestimmung „Beide Ehepartner haben die Pflicht, die Familienplanung
des Staates einzuhalten“ aufgenommen. Die Erfahrung mit der 30-jährigen
juristischen Praxis führte zu folgender Ergänzung: „Die
Scheidung soll gebilligt werden, falls die eheliche Zuneigung zerbrochen
und auch nach Vermittlung nicht wieder zu erlangen ist.“ Weitere
Ergänzungen dienten dem Schutz der Rechte und Interessen von
Alten und dem Schutz der Interessen der Frauen. Zum Beispiel: „Bei
der Scheidung wird das gemeinsame Vermögen der Ehepartner nach
Vereinbarung beider Seiten geteilt. Wird keine Vereinbarung erzielt,
urteilt das Volksgericht zugunsten der Frauen und Kinder.“ Das
zweite Ehegesetz trat am 1. Januar 1981 in Kraft. Die Kulturrevolution
war seit fünf Jahren zu Ende, die Reform- und Öffnungspolitik
stand an ihrem Anfang. Damals kamen die meisten Chinesen zu der
Erkenntnis, dass die echte und solide Grundlage eines starken Staates
seine wirtschaftliche Entwicklung sei. Die in den 50er Jahren von
der Regierung befürwortete Maxime „Mehr Menschen, mehr Kraft“ hatte
in den 30 Jahren danach die uneingeschränkte Vermehrung der
Bevölkerung zur Folge, eine Entwicklung von negativer Tragweite.
Geburtenkontrolle war dringend geboten. Die Einführung der Reform-
und Öffnungspolitik führte zu einer Bewußtseinsveränderung
im Denken der Chinesen. Sie begannen, die Ehescheidung nicht länger
als eine persönliche Schande oder eine Verletzung der sozialen
Gebote zu betrachten. Sie begannen auch, dem Gefühl mehr Bedeutung
beizumessen. Das Wort von Friedrich Engels „Eine Ehe ohne Liebe
ist eine unmoralische Ehe“ machte den Scheidungsantrag noch richtiger.
Diese sozialen Veränderungen erforderten ein neues, ihnen entsprechendes
Ehegesetz. Folgende Punkte wurden darin revidiert oder ergänzt:
Zur Förderung späterer Heirat und damit späterer
Geburt wurde die Ehemündigkeit für Männer um zwei Jahre auf
22 und für Frauen auf 20 erhöht. Zwecks Geburtenkontrolle wurde
die Bestimmung „Beide Ehepartner haben die Pflicht, die Familienplanung
des Staates einzuhalten“ aufgenommen. Die Erfahrung mit der 30-jährigen
juristischen Praxis führte zu folgender Ergänzung: „Die
Scheidung soll gebilligt werden, falls die eheliche Zuneigung zerbrochen
und auch nach Vermittlung nicht wieder zu erlangen ist.“ Weitere
Ergänzungen dienten dem Schutz der Rechte und Interessen von
Alten und dem Schutz der Interessen der Frauen. Zum Beispiel: „Bei
der Scheidung wird das gemeinsame Vermögen der Ehepartner nach
Vereinbarung beider Seiten geteilt. Wird keine Vereinbarung erzielt,
urteilt das Volksgericht zugunsten der Frauen und Kinder.“
 An
folgenden Beispielen kann man sehen, wie tief die Veränderungen
nach Veröffentlichung des neuen Gesetzes waren und welche Rolle
es in der Gesellschaft spielte. An
folgenden Beispielen kann man sehen, wie tief die Veränderungen
nach Veröffentlichung des neuen Gesetzes waren und welche Rolle
es in der Gesellschaft spielte.
Im November 1981 gründete sich die Gruppe „Qin
Xianglian“ in Beijing. Sie bestand aus 25 böswillig verlassenen
Frauen. Qin Xianglian war eine Frau in der Song-Dynastie (960-1279).
Um ihrem Mann das Studium und den Aufstieg durch die Staatsexamen
zu ermöglichen, bestritt sie mit mühsamer Arbeit zunächst
seinen Unterhalt, ernährte dann die ganze Familie und kümmerte
sich schließlich auch noch um ihre Schwiegereltern bis zu
deren Tod. Nachdem ihr Mann die kaiserlichen Examina als Bester
bestanden hatte, verließ er sie und heiratete eine Tochter
des Kaisers. Die oben erwähnten 25 Frauen schrieben gemeinsam
einen Brief an Hu Yaobang, den damaligen Generalsekretär der
KP Chinas, in dem sie ihn aufforderten, dafür zu sorgen, dass diejenigen,
die Familien zerstörten, gerichtlich belangt werden und den
Frauen Schadensersatz zahlen sollten.
 Im
März 1983 veröffentlichte das Ministerium für Zivilangelegenheiten
„Die Bestimmungen über die Registrierung von Eheschließungen
zwischen Auslandschinesen oder Landsleuten aus Hongkong und Macao
mit Bürgern der Volksrepublik China“. Im August 1983 kamen „Die
Bestimmungen über die Registrierung von Eheschließungen zwischen
chinesischen Staatsbürgern und Ausländern“ hinzu. Im
März 1983 veröffentlichte das Ministerium für Zivilangelegenheiten
„Die Bestimmungen über die Registrierung von Eheschließungen
zwischen Auslandschinesen oder Landsleuten aus Hongkong und Macao
mit Bürgern der Volksrepublik China“. Im August 1983 kamen „Die
Bestimmungen über die Registrierung von Eheschließungen zwischen
chinesischen Staatsbürgern und Ausländern“ hinzu.
1982 benutzten Justizbehörden und Frauenverbände
das neue Ehegesetz als Waffe und kämpften gegen die Misshandlung
und Tötung von Frauen und Kindern, kritisierten Denken und
Verhalten, die gegen die sozialistische Moral verstießen,
wie Diskriminierung von Frauen, Untreue und Einmischung in die Ehe
durch eine dritte Person. Leute, die Frauen und Kinder entführten
und verkauften, wurden gesetzlich bestraft. Tang Shuzhen aus der
Provinz Heilongjiang, die keinen Jungen, aber sechs Mädchen
auf die Welt gebracht hatte, wurde von ihrem Mann beschimpft und
geschlagen. Sie wagte aber nicht, darüber offen zu sprechen. Nach
Veröffentlichung des neuen Ehegesetzes traute sie sich jedoch
zum Frauenverband und bat, man solle sie von der Misshandlung durch
ihren Mann befreien. In der Provinz Hunan kamen 229 Leute, die zuvor
nicht für den Unterhalt ihrer Eltern aufkommen wollten, nach Durchsetzung
des neuen Ehegesetzes ihren Pflichten nach.
Das dritte Ehegesetz
 Mit
der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 20 Jahre haben sich
nicht nur die Bedingungen, sondern auch die Vorstellungen der Menschen
gewaltig verändert. Westliches Denken hat einen eindeutigen
Einfluß auf das Leben der Chinesen ausgeübt. Die Folgen sind
teilweise progressiv, haben aber auch Rückschritte gebracht, d.h.
Probleme, gerade im Bereich von Ehe und Familie, die es so zuvor
noch nicht gegeben hat. Deshalb wurde eine erneute Revision des
Ehegesetzes notwendig. Mit
der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 20 Jahre haben sich
nicht nur die Bedingungen, sondern auch die Vorstellungen der Menschen
gewaltig verändert. Westliches Denken hat einen eindeutigen
Einfluß auf das Leben der Chinesen ausgeübt. Die Folgen sind
teilweise progressiv, haben aber auch Rückschritte gebracht, d.h.
Probleme, gerade im Bereich von Ehe und Familie, die es so zuvor
noch nicht gegeben hat. Deshalb wurde eine erneute Revision des
Ehegesetzes notwendig.
Unter Fachleuten und in der Öffentlichkeit
wurde intensivst über das neue, das dritte Ehegesetz diskutiert.
Die Schwerpunkte der Debatte waren, ob „Bao Ernai“ (Konkubinat)
eine strafbare Handlung konstituiere, wie man Gewalt in der Familie
gesetzlich behandeln solle und ob eine notarielle Beglaubigung von
vorehelichem Vermögen im Ehegesetz verankert werden solle.
Von manchen Experten wurde auch vorgeschlagen, die Homosexualität
durch Einbeziehung in das Ehegesetz zu entkriminalisieren – ein
weiteres Beweis dafür, wie groß die Veränderungen in
der chinesischen Gesellschaft sind:
Erstens: Während früher die einzige Form
des Zusammenlebens – für Männer wie für Frauen – die Ehe war,
wobei unverheiratet oder aber verheiratet und kinderlos zu sein
als soziales Stigma galt, gibt es jetzt eine ganze Reihe verschiedener
Lebensformen. Die Ehe ist zwar nach wie vor die Hauptform, aber
auch andere Arten werden praktiziert, so das Zusammenleben gleichgeschlechtlicher
Partner und das Leben als alleinerziehende Mutter bzw. alleinerziehender
Vater sowie das Leben als Single und natürlich „Bao Ernai“.
Zweitens: Während früher aus vorwiegend wirtschaftlichen
Gründen oder Fortsetzung der Familie geheiratet wurde, sind die
Motive heute Liebe, Sexualität und ein Bedürfnis nach Geborgenheit.
Wer sich scheiden lassen will, weil er mit dem Eheleben nicht zufrieden
ist, kann die Scheidung beantragen. Ehepartner, die keine Zuneigung
mehr zueinander haben, sich aber wegen ihres Kindes oder ihrer Kinder
nicht scheiden lassen wollen, suchen oft außereheliche Liebe,
manche auch die käufliche Liebe, was einen Nährboden für
Prostitution bietet.
 Drittens:
Die ethische Grundlage für die Entscheidung zur Eheschließung
verlagert sich allmählich von der Familie auf die einzelne
Person. Die These „Die Familie ist die soziale Zelle, die familiäre
Stabilität ist Garant für die soziale Stabilität“ wird
nicht mehr allgemein akzeptiert. Man legt heute mehr Wert auf das
persönliche Glück und ist der Ansicht, dass die Ehe eine persönliche
Angelegenheit ist und nichts mit sozialer Stabilität zu tun
hat. Deshalb ist man auch nicht länger bereit, in einer Ehe
ohne Liebe zu leben. Die meisten Chinesen meinen, dass eine Scheidung
allein die Betroffenen angehe. Manche jungen Leute bekennen sich
sogar zu einem Zusammenleben ohne Eheschließung und wollen
sich nicht durch eine Ehe binden. Drittens:
Die ethische Grundlage für die Entscheidung zur Eheschließung
verlagert sich allmählich von der Familie auf die einzelne
Person. Die These „Die Familie ist die soziale Zelle, die familiäre
Stabilität ist Garant für die soziale Stabilität“ wird
nicht mehr allgemein akzeptiert. Man legt heute mehr Wert auf das
persönliche Glück und ist der Ansicht, dass die Ehe eine persönliche
Angelegenheit ist und nichts mit sozialer Stabilität zu tun
hat. Deshalb ist man auch nicht länger bereit, in einer Ehe
ohne Liebe zu leben. Die meisten Chinesen meinen, dass eine Scheidung
allein die Betroffenen angehe. Manche jungen Leute bekennen sich
sogar zu einem Zusammenleben ohne Eheschließung und wollen
sich nicht durch eine Ehe binden.
Viertens: Hinsichtlich der ehelichen Moral
spricht man nicht mehr von der Treue und Gehorsamspflicht der Frauen
gegenüber den Männern, sondern von der Selbständigkeit
der Frau. Die Frauen sind nicht länger Anhängsel und gar
Werkzeug der Männer. Sie postulieren ihr Recht auf Liebe und
sexuelle Erfüllung. Immer mehr Frauen finden es keineswegs tugendhaft,
in einer Ehe ohne Liebe zu verbleiben, und bringen sogar Toleranz
und Mitgefühl für außereheliche Liebe auf. Trotzdem, auch
wenn die traditionelle Vorstellung von Ehetreue kritisiert wird,
so hat sie doch noch einen großen Einfluß auf die Gesellschaft.
Fünftens: Man versucht, der Ehe ein Fundament
zu geben, das über die Heiratsurkunde oder die Existenz eines Kindes
hinausgeht, und an ihrer Beständigkeit zu arbeiten. Man weiß,
dass die Liebe kein Schoßhund ist, den man festbinden kann.
Ältere Frauen jedoch, die aus wirtschaftlichen Gründen kaum
selbständig sind und die ihre Männer nicht verlieren und
ihr Kind geschützt sehen wollen, hoffen darauf, dass das neue Ehegesetz
die Scheidungsmöglichkeiten einschränkt.
Das dritte Ehegesetz soll, so die Meinung in breiten
Kreisen der Bevölkerung, Ehe und Familie stabilisieren und
die Rechte und Interessen von Frauen und Kindern besser schützen.
Es soll wirksam gegen „Bao Ernai“ vorgehen und die außereheliche
Liebe einschränken sowie eine Senkung der Scheidungsrate bewirken.
Gewalt in der Familie soll durch Bestrafung der Täter reduziert
werden. Hinsichtlich des Familienvermögens sollen klare Bestimmungen
ausgearbeitet werden.
Doch wie das erreicht werden soll, darüber gibt
es große Meinungsunterschiede. Die eine Seite meint, man müsse
mit harten Mitteln gegen jeden vorgehen, der die Ehestabilität
verletze. Gewalt in der Ehe solle als Verletzung der Persönlichkeitsrechte
des anderen geahndet werden. Der Täter müsse bestraft werden
und einen Schadensersatz zahlen. So könne man „Bao Ernai“ und
außereheliche Liebe erfolgreich einschränken und gleichzeitig
die Scheidungsrate senken sowie Frauen und Kinder schützen. Die
andere Seite hingegen ist der Meinung, dass der Einsatz von harten
Mitteln keine Lösung der Probleme bringe, sondern sie im Gegenteil
sogar eskaliere, weil dadurch der friedliche Weg verbaut werde,
Frauen und Kinder also keineswegs wirksam geschützt würden. Nur
Änderungen langfristiger Natur zum Beispiel in der Erziehung
könnten dies bewerkstelligen, wobei gegen ein vernünftiges
und indirektes Mittel wie Geldstrafen nichts einzuwenden sei.
Von Chen Xinxin
|