Der
Potala
Von
Ou Chaogui

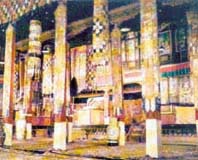
Die weltbekannte 13stöckige
ehemalige Palastburg (Potala) des Dalai Lama liegt auf einem
Bergrücken in der alten Stadt Lhasa (3700 m ü.d.M.). Sie
ist das höchst gelegene Bauwerk der Erde. Lhasa selbst
liegt auf dem Tibet-Plateau - dem „Dach der Welt“. Der kürzlich
fertig renovierte Potala verkörpert konzentriert die
Tradition und den einzigartigen Stil der alten tibetischen
Baukunst. Er zieht immer mehr Touristen aus dem In- und
Ausland.
Eine lange Geschichte
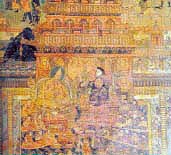 Der
Potala kann auf eine Geschichte von mehr als 1300 Jahren
zurückblicken. Nach historischen Aufzeichnungen war der
Bau des Palastes mit dem Einzug einer Prinzessin der Tang-Dynastie
(618-907) in Tibet verknüpft. Im Jahre 641 hatte nähmlich
der damalige Tang-Kaiser die Prinzessin Wen Cheng mit dem
tibetischen König Srong-btsansgam-po (617-650) verheiratet.
Begleitet von Boten der Tang-Dynastie und mit reichlicher
Mitgift hatte die intelligente und prächtig gekleidete
Prinzessin einen tiefen Eindruck auf den König von
Tibet gemacht, der dann nach seiner Rückkehr nach Lhasa
beschloss, zu Ehren der Prinzessin und als Zeugnis für kommende
Generationen eine Burg bauen und ein besonderes Schloß
für die Prinzessin errichten zu lassen, um sie zu beherbergen.
Dieses im Zentrum von Lhasa befindliche Bauwerk mit 1000
Gemächern war die erste Form des Potala. Mit der Verbreitung
des Buddhismus hielten die Gläubigen dann diesen Palast
für die heilige Stätte, den Buddha-Berg. Und fortan
heißt er nach diesem Berg auf sanskrit „Potala“.
Der
Potala kann auf eine Geschichte von mehr als 1300 Jahren
zurückblicken. Nach historischen Aufzeichnungen war der
Bau des Palastes mit dem Einzug einer Prinzessin der Tang-Dynastie
(618-907) in Tibet verknüpft. Im Jahre 641 hatte nähmlich
der damalige Tang-Kaiser die Prinzessin Wen Cheng mit dem
tibetischen König Srong-btsansgam-po (617-650) verheiratet.
Begleitet von Boten der Tang-Dynastie und mit reichlicher
Mitgift hatte die intelligente und prächtig gekleidete
Prinzessin einen tiefen Eindruck auf den König von
Tibet gemacht, der dann nach seiner Rückkehr nach Lhasa
beschloss, zu Ehren der Prinzessin und als Zeugnis für kommende
Generationen eine Burg bauen und ein besonderes Schloß
für die Prinzessin errichten zu lassen, um sie zu beherbergen.
Dieses im Zentrum von Lhasa befindliche Bauwerk mit 1000
Gemächern war die erste Form des Potala. Mit der Verbreitung
des Buddhismus hielten die Gläubigen dann diesen Palast
für die heilige Stätte, den Buddha-Berg. Und fortan
heißt er nach diesem Berg auf sanskrit „Potala“.
Der ursprüngliche Palast
ist nicht vollständig erhalten, denn im 8. Jahrhundert
entstand ein Brand durch einen Blitzschlag, und im 9. Jahrhundert
wurde der Palast während eines Krieges verwürstet.
Der Palast in seiner heutigen
Form stammt aus dem 17. Jahrhundert. Anfang des 15. Jahrhunderts
wurde eine Glaubensreform in Tibet durchgeführt. Die Gelug
(Gelbe)-Sekte (eine Fraktion des Lamaismus) gewann nach
und nach an Stärke, bis sie Anfang des 17. Jahrhunderts
die mächtigste Klostersekte in Tibet war. Im Jahre
1578 hatte sich ein Lama auf Einladung nach Qinghai zum
Predigen begeben. Seit damals hatte der Lamaismus unter
den Mongolen viele Anhänger. Vor seiner Rückreise war
ihm dann vom mongolischen Oberhaupt der Titel „Dalai Lama
mit heilliger Einsicht“ verliehen worden. (Dalai bedeutet
in mongolischer Sprache „Ozean“ und Lama in tibetischer
Sprache „intelligente und weise Persönlichkeit“. Dalai
Lama bedeutet also Person mit unbegrenzter Weisheit“). Der
Großmeister und der Meister von Soglang-Djialtso wurden
dann posthum zum 1. und zum 2. Dalai Lama erklärt.
1642 errichtete der 5. Dalai Lama (1617-1682) im Zhebang-Kloster
(Lhasa) das örtliche tibetische Regime und begann im
Jahre 1645 mit dem Wiederaufbau des Potala. Nachdem der
Weiße Palast, Hauptteil des Potala, 1653 eingeweiht
worden war, zog der 5. Dalai Lama vom Zhebang-Kloster in
den Palast um. Nach seinem Tod wurde 1690 der Bau der Roten
Palastes in Angeriff genommen und 1693 beendet. Die feierliche
Einweihung fand im selben Jahr am 20. April (nach dem tibetischen
Kalender) statt. Noch heute ist das Denkmal zur Einweihung
unversehrt vor dem Palast zu sehen.
Der Wiederaufbau des Potala
erforderte harte Arbeit. Für die vielen Gemäuer wurde
Erde hinter dem Berg geholt, wo schließlich ein tiefer
See entstand. In der Mitte des Sees erbaute man dann den
Drachenkönig-Tempel, und der See erhielt den Namen
Drachenkönig-See. Historischen Aufzeichnungen zufolge
arbeiteten allein bei der Baustelle des Roten Palastes mehr
als 7000 Menschen. Außerdem fällten noch unzählige
Leibeigene in den Bergen Bäume und holten Steine, transportierten
nur durch Menschenkraft riesige Stämme und Steinblöcke
aus den so weitentferten Orten wie Shannan und Linzhi nach
Lhasa. Beim Überqueren von Bergen und Flüssen starben
viele Tibeter an Hunger und Erschöpfung. Ein Wandgemälde
im Roten Palast beschreibt anschaulich diese harte Arbeit.
Statistiken zufolge wurden allein für den Bau des Roten
Palastes mehr als 2 134 138 Tael Silber ausgegeben. Dabei
mußten die Werktätigen selbst für ihr Essen bezahlen
und ohne Lohn arbeiten.
Majestätisches Kloster
Der Potala wurde am Südhang
errichtet. Sein Hauptgebäude ist 110 m hoch. Er ist
das umfangreichste und vollständigste alte Bauwerk,
das heute noch in Tiebt existiert. Der Weiße und der
Rote Palast unterscheiden sich durch die Farbe der Gemäuer.
Eine breite Steintreppe,
die beiderseits von niedrigen Balustraden geschützt wird,
läuft im Zickzackkurs nach oben und erreicht durch
das Osttor eine Plattform auf dem Berghang, wo früher bei
Festtagen Tänze und Zeremonien zu Ehren der Geistlichen
veranstaltet wurden. Im Gebäude östlich der Plattform
liegt die ehemalige Mönchsschule, die Versammlungshalle
und die Unterkünfte befinden sich westlich. Dort rezitierten
die 154 Lamas, die im Potala lebten, buddhistische Schriften.
Kommt man über die Treppe
nach oben, erreicht man durch einen gewundenen Korridor
die Ost-Halle mit ihren 64 Säulen. Sie ist die größte
im Weißen Palast. Bevollmächtigte der Qing-Dynastie
(1644-1911) führten hier mehrmals den Vorsitz bei den Zeremonien
der Thronbesteigungen und der Amtsantritte der Dalai Lamas.
Die West-Halle, die größte des Roten Palastes,
umfaßt eine Gesamtfläche von mehr als 700 Quadratmetern.
Hier befindet sich die Grabstätte der Ling Ta Dian
(Halle der heiligen Pagode) für den 5. Dalai Lama. Die Ling
Ta Dian, die das Hauptgebäude des Roten Palastes darstellt,
ist ein Stupa (d.h. ein Sakralbau für die Aufnahme von Reliquien
des Buddhas und seiner Jünger und manchmal nur noch ein
reines Kultmal). Nach der Fertigstellung des Stupas für
den 5. Dalai Lama wurden nacheinander auch Stupen für den
7. bis 13. Dalai Lama gebaut. Sie waren zwar von unterschiedlicher
Größe, aber alle gleich strukturiert. Die Stupen
in Pagedenform, mit Blattgold überzogen, (daher in historischen
Aufzeichnungen auch Goldpagoden genannt) sind alle mit Perlen
und Edelsteinen besetzt. Der Stupa des 13. Dalai Lama ist
mit 18 000 Tael Gold verkleidet und der des Großen
Fünften sogar mit 110 000 Tael. Der Wert der verwendeten
Edelsteine übertrifft den des Goldes fast um das 10fache.
Von immer brennenden Butterlampen erhellt, stehen die Pagoden
in Weihrauch gehüllt und beherbergen die Reliquien der Dalai
Lamas. Es heißt, dass alle Leichname besonders präpariert
wurden. Nach einer glaubwürdigen Überlieferung soll
der Leihnam eines Dalai Lama noch Dutzende von Tagen nach
dem Eintritt des Todes in der Halle ausgestellt gewesen
sein, damit die Gläubigen ihm die letzte Ehre erweisen
und Opfergaben spenden konnten. Anschließend soll
der Leichnam in Salz gelegt, getrocknet, dann einbalsamiert
und in Mönchsgewänder gehüllt worden sein. Das
Gesicht sollen Maler wieder nachgezogen haben. Erst danach
soll die Beisetzung in einem Stupa stattgefunden haben.
Die Privatgemächer der
Dalai Lamas befinden sich im obersten Stockwerk des Weißen
Palastes und umfassen Andachts-, Gebets-, Empfangs- und
Schlafzimmer, in denen alle möglichen unschätzbaren
Gegenstände ausgestellt sind. Zwei in Tigerpelz gehüllte
Knüppel an der Tür, auch „Knüppel der Autorität“ genannt,
versinnbildlichten die Macht der herrschenden Klasse. Der
Gebetssitz der Dalai Lamas befindet sich auf der nördlichen
Seite des Andachtszimmers. Unter den geheiligten Gegenständen
daneben befinden sich Handtrommeln, mit Menschenhaut bespannt,
und Trinkgefäße aus Menschenschädeln. Nur
Beamte vom 4. Rang aufwärts waren berechtigt, an Beratungen
in diesem Gemach teilzunehmen.
Das älteste, noch existierende
Bauwerk des Potala ist die im Nordostteil des Roten Palastes
gelegene Kapelle des Guanzin-Bodhisattwa, wo der Sage nach
der König Srong-btsan-sgam-po und die Prinzessin Wen
Cheng die ersten Nächste nach ihrer Hochzeit verbracht
haben sollen. Die Statuen dort gehören zu den künstlerischen
Besonderheiten der Tufan-Periode. Im ersten Stock der Halle
wird an einer Stelle das Ebenbild des Srong-btsan-sgampo
verehrt. Über diese Statue erzählt man sich die
folgende Geschichte: Ein Lama hatte einmal in einem dichten
Wald in Südtibet einen helleuchtenden Sandelholzbaum entdeckt,
der leise sprechen konnte. Er fällt den Stamm, und
daruafhin entstand aus jedem Stück ein Buddha. Der vierte
davon wurde später zur Verehrung in den Potala transportiert.
In dem höchsten, „Sasonglongjie“
genannten Gebäude des Potala ist das Abbild des Kaisers
Qian Long aus der Qing-Dynastie zu sehen und außerdem
eine Ehrentafel für diesen Kaiser, auf der in chinesischer,
tibetischer und mandschurischer und mongolischer Sprache
geschrieben steht: „Ein langes, langes Leben dem heutigen
Kaiser“. Der Dalai Lama huldigte an jedem Neujahrstag hier
dem Kaiser.
Vom Dach der Palastburg aus
kann man die ganze Stadt überblicken, die 100 m hohen Mauern
erheben sich senkrecht von dem Berghang. Ein Blick von den
Zinnen lässt einen erschaudern, wenn man an diei Seilakrobatik
denkt, die hier an jedem 2. Januar nach dem tibetischen
Kalender stattfand. Die Vorführung war atemberaubend: Auf
vier, je über 100 m langen Lederseilen, die zwischen der
höchsten Zinne und einem Pfeiler am Fuß des Berges
gespannt waren, rutschten Seilartisten, nur mit einem kurzem
Hemd und einem Brustschutz aus Rindsleder bekleidet und
weißen Bannern in den Händen, den Kopf nach unten,
in die Tiefe. Sie mußten die Fahrt drei- bis viermal
wiederholen. Die Akteure waren Leibeigene aus dem hinteren
Tibet, denen für jede gelungene Fahrt ein Jahr Frondienst
erlassen wurde. Da es aber keine Sicherheitsmaßnahmen
gab, kamen viele ums Leben.
Architektur
Die tibetischen Schlösse
befinden sich meistens auf Bergen. Die älteste tibetische
Burg wurde auf dem Gipfel eines hohen Berges im Shannan-Gebiet
erbaut. Auch beim Bau des Potala wurde nach dieser Tradition
verfahren. Das Fundament ist oft tief im Felsen verankert.
Und aus dem Berghang ragen die Mauern, nach hinten leicht
geneigt, heraus, so dass es den Anschein hat, als wüchsen
sie aus dem Berg empor, um diesen mächtiger erscheinen
zu lassen. In manche der meterdicken Mauern wurde sogar
flüssiges Kupfer zwecks Stabiltität und gegen Erschütterung
hineingegossen. An der Außenseite zwischen den Grundmauern
und den Nebenmauern sieht man einen schönen dunkelroten
Gürtel, der aus Bündeln von einer einheimischen Pflanze
besteht. Die vielstöckigen Gebäude sind nach einer
Holzkonstruktion gebaut. Die Balken liegen auf Säulen,
die Bodenbretter und Sparren liegen wiederum auf Balken,
darauf eine dicke Erdschicht (hauptsächlich aus natürlichem
Kalk), die als Massivdecke oder Dache dient. Die Traufen
aller wichtigen Burgen wurden der Architektur der Han-Nationalität
nachgebaut. Die Doppeldächer werden von komplizierten
äußeren Stützgebälken getragen, die ohne
Nagel miteinander verzapft sind. Wie ein Schirm erstrecken
sich die Gesimse und Golddächer in Form eines Helms
nach allen Seiten. An den vier herausragenden Dachkanten
hängt je eine Glocke. Die Dächer sind mit heiligen
Vögeln und Wundervasen in Pagodenform geschmückt.
Die Wandgemälde des
Potala wurden von berühmten tibetischen Malern des 1. Jahrhunderts
mit großer Sorgfalt angefertigt. Die lebendigen bunten
Gemälde sind nicht nur durch die buddhistische Kunst
geprägt, sondern widerspiegeln auch anschaulich das
kulturelle Leben der tibetischen Bevölkerung. Bogenschießen
vom Pferd aus, Ringen, Gewichtheben mit Steinblöcken
sind zu sehen.
Die
dargestellten Geschichten erregen das Interesse des Besuchers.
Insbesonders über die Prinzessin Wen Cheng gibt es viele
Erzählungen. Ein Wandgemälde verdeutlicht, wie
der Bote von Tufan die fünf Fragen des Tang-Kaisers beantwortete,
als er in der Hauptstadt der Tang-Dynastie, Changan (heute:
Xi’an), die Prinzessin begrüßte. Damit sollte die Weisheit und
Intelligenz der tibetischen Bevölkerung zum Ausdruck
gebracht werden.
Im Jahre 710 wurde eine andere
Han-Prinzessin namens Jin Cheng nach Tibet verheiratet.
Ein Fresko über dieses Ereignis zeigt u.ä. folgende
interessante Geschichte: Die Prinzessin Jin Cheng hatte
einen Wunderspiegel, der Glück und Unheil vorhersagen konnte.
Von dem Wunsch getrieben, sofort ihren Bräutigam zu
sehen, hatte sie, nachdem sie ein Gebet geprochen hatte,
sofort in den Spiegel geschaut und darin einen schönen
Jüngling erblickt. Unterwegs auf dem Weg nach Tibet überkam
sie dann aber plötzlich ein seltsames Gefühl. Sie sah
nochmals in den Spiegel und erblickte diesmal statt des
Jünglings einen alten weißhaarigen Mann. Erst nach
ihrer Ankunft verstand sie den Wandel: Um mit der Prinzessin
so schnell wie möglich zusammenzutreffen, war der Prinz
ihr entgegengeritten, dabei aber vom Pferd gestürzt und
ums Leben gekommen. So mußte die Prinzessin in Lhasa
den alten König heiraten.
Viele Wandgemälde sind
wichtiges historisches Material. So zeigt eines der Zusammenkunft
des Qing-Kaisers Shun Zhi mit dem 5. Dalai Lama 1652 und
ein anderes den Empfang des 13. Dalai Lama durch den Kaiser
der Qing-Dynastie Guang Xu und die Kaiserinwitwe Ci Xi 1908.
Die tibetischen Wandgemälde
zeichnen sich durch klare Linien in Schwarz und Gold und
durch kontrastreiche Farben aus.
Erhaltung und Forschung
Seit der Befreiung schenken
die Partei und die Volksregierung der Erhaltung dieses weltbekannten
Bauwerkes große Beachtung und geben seither jedes
Jahr eine Sondersumme zur Erhaltung des Potala. Bedauerlicherweise
wurden aber ein Teil des Potala und viele Kulturgegenstände
während des Putsches der reaktionären Clique der
tibetsichen Oberschicht im Jahre 1959 schwer beschädigt.
Viele wertwolle Kulturschätze wurden dabei sogar entwendet.
Früher wurde jährlich am 1. März (nach dem tibetischen
Kalender) ein mehrere Dutzend Meter hohes Buddha-Porträt
aus Seide an der Frontseite des Potala angebracht, damit
die Budhisten ihn verehren konnten. Zu dieser Zeit wurden
dann auch die im Potala aufbewahrten Kostbarkeiten zur Schau
gestellt. Ein sehr wertvolles Perlen-Kostüm, das damals
stets Bewunderung erweckte, ist, soweit bekannt, bereits
abhanden gekommen.
1961 gab der Staatsrat bekannt,
dass der Potala als Schwerpunktprojekt dem staatlichen Denkmalschutz
unterstellt sei. Eine Gruppe zur Pflege und Erforschung
der Kulturgegenstände des Palastes wurde anschließend
ins Leben gerufen. Seither hat sie große Anstregungen
unternommen und Zehntausende wertwoller Gegenstände
in Ordnung gebracht.
Die im Potala aufbewahrten
kaiserlichen Edikte und Siegel zeigen, dass die chinesische
Zentralregierungen im Laufe der Geschichte die Verwaltung
von Tibet nach und nach verstärkten und vervollkommneten.
Im Jahre 649 wurde König Srong-btsan-sgam-po vom Tang-Kaiser
Gao Zong zum König des Xihai-Distrikts ernannt. Das
Siegel dafür ist jedoch verschwunden. Aber viele Edikte
und Siegel seit der Yuan-Dynastie (1271-1368) sind erhalten.
Eines dieser wertvollen Siegel ist ein Jadesiegel, das von
der Yuan-Dynastie den Sajia-Adligen verliehen wurde. Ferner
gibt es noch eine Anzahl von Edikten und Siegeln, die sich
auf das Ansuchen der verschiedenen tibetischen Abteilungen
um Verleihung von Ehrentiteln und die Bestätigung der
Herrschaft der Könige von Tibet in der Ming-Dynastie
(1368-1644) beziehen. Unter den vielen lokalen Beamten Tibets,
die von der Qing-Dynastie ernannt wurden, waren Dalai Lama
und Pantschen die wichtigsten. 1652 reiste der 5. Dalai
Lama nach Beijing, um dem Kaiser der Qing-Dynastie Shun
Zhi die Ehre zu erweisen. Im darauffolgenden Jahr wurde
ihm der Titel „Buddha mit Gnade und Buße in der Westlichen
Welt - Dalai Lama, der alle Buddhisten unter dem Himmel
führt“ verliehen, und er bekam vom Kaiser Shun Zhi ein Goldenes
Album und ein Goldsiegel. Seit damals wurde die Bezeichnung
Dalai Lama von der zentralen Regierung anerkannt. Die späteren
Dalai Lamas mussten ausnahmslos von den zentralen Regierungen
ernannt werden. Jeder verstoß gegen ihren Willen bedeutete
die Amtsenthebung des betreffenden Dalai Lama. Der 13. Dalai
Lama wurde z. B. 1904 und 1910 zweimal seines Amtes enthoben,
weil er ohne Einwilligung der Zentralregierung Tibet verließ.
Die Goldsiegel und Goldenen Alben mit den Ernennungen der
Dalais und Pantschen werden vom Komitee für die Kontrolle
der Kulturgegenstände des Autonomen Gebiets Tibet,
das im Park Norbu Lingka seinen Sitz hat, aufbewarht. Auch
die Vase „Jin Ben Ba“ („Jin“ auf Chnesisch Gold, „Ben Ba“
auf Tibetisch Vase) ist hier ausgestellt. Nach der Lehre
des Lamaismus geht das Überirdische eines verstorbenen
Lama in ein neugeborenes Kind über, das in seiner Todesstunde
zur Welt kommt. Da aber meistens in diesem Moment viele
Kinder auf die Welt kamen, um die Inkarnation des Dalai
Lama ausfindig zu machen, unter Aufsicht des Ministers der
Zentralregierung in Tibet ein Los aus der Goldvase gezogen.
So wurde der neue Dalai Lama ausgelost.
Eine andere Kostbarkeit ist
der Bei Ye Jing, der aus Blättern besteht, auf die
Sutras in Sanskrit geschrieben sind. Dies sind wertvolle
Dokumente zur Erforschung von Politik, Wirtschaft, Religon
und Kultur der alten Zeit. Dank dem günstigen Klima und
den gesellschaftlichen Bedingungen sind heute noch ziemlich
viele Bei Ye Jing in Tibet vollständig erhalten. Anderswo
findet man sie nur noch sehr selten.
(Aus „China im Aufbau“, Nr. 3,1980)

