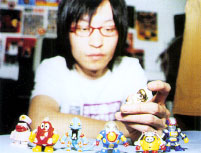 Das
Zeitalter
des
Cartoons
Das
Zeitalter
des
Cartoons
Von Zhou
Yang
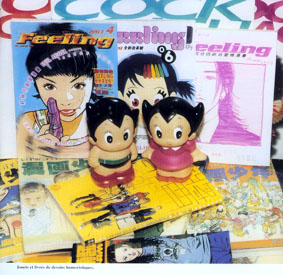
Es war ein heißer Sommertag. Wie immer
hatte Li Wanzhuo pünktlich um fünf Uhr Feierabend. Sie fuhr
im Verkehrsstrom durch halb Beijing zu ihrer Wohnung im südlichen
Stadtteil, kochte hastig etwas und setzte sich nach dem Essen
zusammen mit ihrer Tochter vor den Fernseher, um sich die japanische
Cartoon-Serie „Sakura momoko“ anzuschauen.
 „Sakura
momoko“ erzählt von der Freude, Wut, Trauer und Fröhlichkeit,
die ein siebenjähriges Mädchen während ihres
Aufwachsens erlebt. Diese Cartoon-Serie ist bereits zum Hauptgesprächsthema
von Frau Li und ihren Kollegen geworden. Ihre Tochter, die die
vierte Schulklasse besucht, sagt: „Meine Mutti ist nicht mehr
so launisch wie früher und behandelt mich eher wie eine Freundin.“
Frau Li meint: „Das Verhalten von Momoko ist nicht geprägt
durch Heuchelei, wie sie bei Erwachsenen so oft vorkommt. Wenn
ich, als Städterin, die es gewohnt ist, unter einer Maske
zu leben, ihr zuschaue, fühle ich mich sehr entspannt und frei...“
Manche Leute sind der Ansicht, dass der Humor in diesem Zeichentrickfilm
den Hauptgrund für seine Faszination darstellt, während
die Psychologen meinen, zwar seien die ungekünstelte Ausdrucksform,
die künstlerischen Mittel und die Anwendung von Computertechnik
wesentlich für die Beliebtheit des Cartoons, aber letztlich
seien es doch der Durchblick und das tiefe Verständnis
für das Leben, die den reichen Inhalt der Serie ausmachen und
die Menschen zum Nachdenken anregen.
„Sakura
momoko“ erzählt von der Freude, Wut, Trauer und Fröhlichkeit,
die ein siebenjähriges Mädchen während ihres
Aufwachsens erlebt. Diese Cartoon-Serie ist bereits zum Hauptgesprächsthema
von Frau Li und ihren Kollegen geworden. Ihre Tochter, die die
vierte Schulklasse besucht, sagt: „Meine Mutti ist nicht mehr
so launisch wie früher und behandelt mich eher wie eine Freundin.“
Frau Li meint: „Das Verhalten von Momoko ist nicht geprägt
durch Heuchelei, wie sie bei Erwachsenen so oft vorkommt. Wenn
ich, als Städterin, die es gewohnt ist, unter einer Maske
zu leben, ihr zuschaue, fühle ich mich sehr entspannt und frei...“
Manche Leute sind der Ansicht, dass der Humor in diesem Zeichentrickfilm
den Hauptgrund für seine Faszination darstellt, während
die Psychologen meinen, zwar seien die ungekünstelte Ausdrucksform,
die künstlerischen Mittel und die Anwendung von Computertechnik
wesentlich für die Beliebtheit des Cartoons, aber letztlich
seien es doch der Durchblick und das tiefe Verständnis
für das Leben, die den reichen Inhalt der Serie ausmachen und
die Menschen zum Nachdenken anregen.
 „Sakura
momoko“ wurde bereits fünfmal im Fernsehen gesendet, trotzdem
riefen viele Zuschauer beim Fernsehsender an und baten um eine
Wiederholung.
„Sakura
momoko“ wurde bereits fünfmal im Fernsehen gesendet, trotzdem
riefen viele Zuschauer beim Fernsehsender an und baten um eine
Wiederholung.
Seit den Anfängen des Zeichentrickfilms
in China herrschte die Vorstellung vor, er sei nur für Kinder
bestimmt. Doch nach 40 Jahren hat sich dies total geändert.
Zahlreiche Erwachsene sehen nun auch gern Zeichentrickfilme,
so dass die wenigen Cartoon-Filme in China die Nachfrage nicht
decken können. Hinzu kommt die Kritik über allzu naive
Inhalte, unattraktive Handlungen, schlechte Synchronisation
und über die Musik. Viele Webseiten haben für Internet-Benutzer
eine eigene Cartoon-Welt errichtet. Die Comics in Zeitschriften
gewinnen immer mehr Leser. Viele ausländische Bücher und
Zeitschriften über Comics und Cartoons wurden ins Chinesische
übersetzt, wobei besonders die USA und Japan viel davon profitiert
haben.
Gegenwärtig richten die Cartoonmacher
in den USA und Japan ihre Blicke auf den chinesischen Markt.
Der Preis ihrer Produkte ist sehr niedrig, eine Minute kostet
zum Teil nicht mehr als fünf Yuan. Ein äußerst ungewöhnlicher
Fall betraf den US-amerikanischen Zeichentrickfilm „Transformer“.
Die Hasbro Toy Company schenkte ihn dem chinesischen Zentralfernsehen
CCTV, verdiente aber in der Folge von chinesischen Kindern fast
fünf Milliarden Yuan mit Spielzeug, das sich auf den Film bezog.
Der chinesische Cartoon-Markt befindet sich in der Übergangsphase
vom Planwirtschafts- zum Marktwirtschaftssystem. Der ausländische
Zustrom von Cartoonfilmen erschwert chinesischen Cartoonproduzenten
das Leben zusätzlich.
Das bekannte Shanghaier Zeichentrickfilmstudio
hat viel für die Vermarktung von Cartoonfilmen getan. Mit der
„Lotoslaterne“ wurde zum ersten Mal Gewinn erzielt, doch die
Vermarktung beschränkte sich auf VCD, CD und Bilderbücher.
In letzter Zeit ist der Zeichentrickfilm „Ich bin verrückt nach
Liedern“ in ganz China bekannt geworden. Die Einnahmen aus dem
Merchandising machten 2/3 der Gesamteinnahmen aus. Noch bevor
der Film in die Kinos kam, wurde in den Medien heiß darüber
berichtet. Seine Nebenprodukte wie der Roman, Comics und CDs
wurden in mehreren Städten verkauft. Doch der Erfolg konnte
sich kaum mit den internationalen Einsätzen für einen Cartoonfilm
vergleichen. Allein „Lion King“ erreichte mit Investitionen
von 45 Mio. US-Dollar Gewinne im Wert von 750 Mio. US-Dollar.
Die Einführung des Marktsystems verlief nicht
reibungslos. Der neue Cartoonfilm „Ich bin verrückt nach Liedern“
versuchte, Mittelschüler als Zielgruppe anzusprechen und entsprechende
Produkte zu verkaufen. Aber der Film fiel bei den Kritikern
durch. Sie meinten, dass der Film von der Handlung über die
Figuren bis zu den Nebenprodukten zu japanisch sei und kritisierten
auch, dass selbst die Filmproduzentin, die Firma Dacheng, auf
Englisch mit „TAISEI“ übersetzt sei, offensichtlich nach der
japanischen Aussprache. Dem entgegnete Herr Kong, Manager der
Firma Dacheng: „Die Mittelschüler von heute schwärmen für
japanische Dinge. Wenn wir Profit machen wollen, können
wir nur diesen Weg gehen.“ Kritiker machen sich darüber Sorgen,
dass der chinesische Cartoonfilm auf Irrwege geraten könnte.
Daneben wird die Entwicklung des chinesischen
Cartoonfilms und verwandter Produkte von Raubkopien beeinträchtigt.
Aus Furcht vor Raubkopien wollen viele Verlage keine Comics-Bücher
oder -Zeitschriften herausgeben. Viele Kulturfirmen fördern
die Zeichner nur beschränkt, so dass die Entwicklung des
Cartoon-Sektors zusätzlich erschwert wird. Viele ausgezeichnete
Zeichner sind schon ins Ausland abgewandert.
Frau Zhi Zhi, Generalsekretärin des Jugendvereins
für Comics und Cartoons der Stadt Guangzhou, bedauert: „In Guangzhou
ist es für Zeichner sehr schwer, ein Einzelwerk herauszugeben.
Kein Verlag will das Risiko eingehen. Es gibt auch keine Verleger
wie in Hongkong oder Japan, die eine umfassende Marketing-Compagne
für einen Zeichner durchführen.“ Obwohl sie Comics liebt, bemerkt
sie etwas bedrückt: „Hierzulande kann man tatsächlich nicht
davon leben.“
Viele Comics-Zeichner leben nun im Ausland.
Nach konservativen Schätzungen arbeiten etwa 300 Zeichner
in ausländischen Firmen.
Li Yi, mit Pseudonym „Blutgruppe 0“, sehnt
sich nach Freiheit und drückt gern mit seinem Pinsel im freien
Stil seine Gefühle über das Leben und die Welt aus. Nun beschäftigt
er sich hauptsächlich mit dem Zeichnen von Illustrationen.
Sein Verstand obsiegte und ließ ihn seinen Traum, im eigenen
Atelier als Zeichner zu arbeiten und davon zu leben, vorübergehend
beiseite legen. Er meint, dass sich der Cartoonsektor in China
erst noch zu einer Industrie entwickeln müsse. Es gebe derzeit
weder eine kulturelle Grundlage noch qualifizierte Investoren,
noch Unterstützung von Seiten der Medien und auch kein Umfeld
für Comics. Er hatte sich voller Hoffnung für Comics eingesetzt
und machte auch Überstunden ohne Entschädigung. Aber
der 25-jährige Mann wurde allmählich realistisch.
Durch viele Änderungen sowohl im Zeichenstil als auch im
Geschäftsverhalten hat er ein Gleichgewicht im Widerspruch
zwischen seinen Interessen und der Realität gefunden.
Die meisten seiner Fachkollegen sind nun in
den Bereichen Film, Fernsehen und Werbung tätig. Sie betrachten
Comic-Strips als ein Mittel, ihre Unzufriedenheit auszudrücken
und sich zu entspannen. Li Yi hat sich von den handlungsreichen
Comics schon etwas abgewendet und richtet seine Aufmerksamkeit
eher auf die Verbindung von Illustration und grafischem Design.
Vielleicht wird er eines Tages gar „Filme auf Papier“ (Cartoons)
zum Laufen bringen.
Ein Fachkollege ist der Ansicht, „der japanische
Comic tendiert zu Gewalt und Sex, während der amerikanische
oft einen individualistischen Heroismus in den Mittelpunkt stellt.
Der chinesische Comic kann das auf keinen Fall übernehmen. Der
chinesische Comic kann sich nur entwickeln, wenn er seinen Blick
auf gute Themen und einen eigenen Stil richtet.“
Bereits im Jahr 1996 lancierte die chinesische
Regierung das Projekt „5155“ mit dem Ziel, einen Comic mit chinesischem
Gepräge zu entwickeln. Herr Ren Qian, Zuständiger
für die Programmverwaltung im Chinesischen Hauptamt für Rundfunk,
Film und Fernsehen, meint, gegenwärtig sei es vordringlich,
eine breite Produktionskapazität für Cartoons aufzubauen.
Zur Zeit sind noch keine rein mit ausländischem Kapital
gegründete Studios erlaubt. Unter Beibehaltung der staatlichen
Kontrollmehrheit soll der Cartoonsektor umgestaltet werden.
Zwei Produktionsstätten, die Abteilung für Cartoons von
CCTV und die Unternehmensgruppe für Cartoonfilme und -serien
in Shanghai befinden sich im Aufbau. Beide werden nach modernen
Methoden geführt werden. Im Moment unterstützt und schützt der
Staat den Cartoon- und Comicsektor. Eine Reihe von Bestimmungen
über die Einfuhr und Ausstrahlung ausländischer Cartoonfilme
wurden bereits erlassen, z. B. darf der Anteil ausländischer
Produkte 40% der gesendeten Cartoons nicht übersteigen.
Gegenwärtig ist der wissenschaftliche
Austausch im Cartoonsektor sehr belebt. Das Chinesische Hauptamt
für Rundfunk, Film und Fernsehen veranstaltete die „Internationale
Cartoonmesse“. „Beijing Cartoon“ organisierte die „Konferenz
für Comics Beijing“. Außerdem veranstaltet das Magazin
„Cartoonkönig“ jedes Jahr im August in Shanghai die „Internationale
Ausstellung für Cartoons und Comics“.



