Auf
den Spuren von Sven Hdin zum Kloster Taschilunpo
Von Dr. Rolf Zimmermann
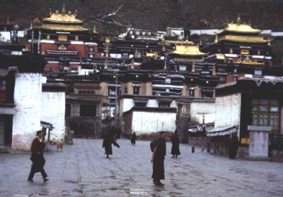 |
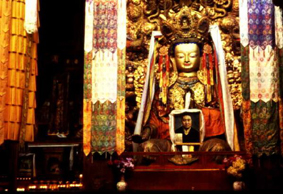 |
| Taschilunpo
mit seinen goldenen Dächern ist nicht das größte
Kloster Tibets, aber als Sitz des Pantschen-Lama eines
der aktivsten |
Die Verehrung
des 1989 verstorbenen 10. Pantschen-Lama ist in allen
tibetischen Klöstern erlaubt |
An das
Essen in Tibet muss man sich erst einmal gewöhnen. Getrocknetes
und in kleine Würfel geschnittenes Yakfleisch ist sehr zäh,
und das gekochte Hammelfleisch trieft vor Fett. Recht gut schmecken
dagegen Momos, entfernte Verwandte unserer schwäbischen
Maultaschen. Und auch der Buttertee ist gar nicht so schlecht,
er schmeckt wie eine Bouillon mit leichtem Tee-Aroma.
Unser Frühstück
im Shigatse-Hotel ist dagegen fast europäisch: Spiegeleier,
leicht gesüßtes Weißbrot und heißer Kaffee,
den wir nach durchfrorener Nacht gut gebrauchen können.
Dennn Shigatse liegt fast 4000 Meter hoch, die Hotelwände
sind dünn, die sternenklare September-Nacht war sehr kalt, und
die Zimmer werden pünktlich nach dem Kalender erst ab 1. Oktober
beheizt.
Shigatse
ist etwa 300 km von Lhasa entfernt und die zweitgrößte
Stadt Tibets. Hauptsehenswürdigkeit ist das Koster Taschilunpo,
das seit Jahrhunderten der Sitz des Pantschen-Lama ist. Der
1989 verstorbene 10. Pantschen-Lama hatte sich mit der Regierung
in Peking arrangiert, daher wurde seine Kosterstadt während
der Kulturrevolution (1966-1976) von chinesisschen Soldaten
vor der Zerstörungswut der Roten Garden geschützt. Sein
Bild und oft auch das seines noch jungen Nachfolgers steht auf
vielen Altären.
Aufgrund
der großen Entfernung zu Lhasa waren die früheren Pantschen-Lama
weitgehend unabhängig vom jeweiligen Dalai-Lama, und es
kam mehrfach zu Machtkömpfen zwischen diesen beiden religiösen
Oberhäuptern der Tibeter. Taschilunpo beherbergte in seiner
Blütezeit bis zu 4000 Mönche; heute sind es etwa 800, die
die riesige Klosteranlage bewohnen.
Und hier
erleben wir im September überraschend ein großes Klosterfet
genau so, wie es Sven Hedin vor fast 100 Jahren beschrieben
hat. Tibet war damals ein für die westliche Welt verbotenes
Land, und Sven Hedin war einer der ersten Europäer, dem
es gelang nach Tibet einzudringen. Er hat Tibet mehrfach bereist,
Lhasa aber nie erreicht und beschreibt als „Höhepunkt seines
Lebens“ seine Ankunft in Shigatse und sein Zusammentreffen mit
dem Pantschen-Lama beim tibetischen Neujahrsfest im Februar
1907.
Sehr interessant
ist es, den Originalbericht von Sven Hedin (Transhimalaja, Band
1, Kapitel 23 und 24, deutsche Ausgabe von 1909, nachfolgend
in einem anderen Schrifttyp gesetzt) einschließlich seiner
für uns kaum nachvollziehbaren politischen Einschätzungen
der Rolle der beiden großen Lama und der chinesen zu lesen
und mit dem heute Erlebbaren zu vergleichen:
„Der 9.
Februar (1907) brach an, der große Tag, an dem unsere
jetzt in sehnsuchtsvolle Pilger verwandelte Karawane das Ziel
ihrer Träume erreichen sollte! Der gestrige Tag war stürmisch
gewesen, und am Abend herrschte eine seltsame, rotgelbe Beleuchtung
im Tal von all dem Staub, der in der Luft umherschwebte; die
Berge zeichneten sich nur undeutlich ab, und im Osten war kein
Horizont zu sehen. Aber der Morgen war herrlich, und der Tag
blieb windstill. Schon in aller Frühe mussten Sonam Tsering
und einige Ladakis sich mit einem Teil der Bagage in zwei Booten
einschiffen, während Muhamed Isa und Tsering mit der Karawande
auf der Landstraße weiterzogen.
Alle anderen
waren schon unterwegs, als Robert, Rabsang und ich in einer
steilen, schluchtähnlichen Rinne die Terrasse hinunterrutschten
und das vorzügliche Fahrzeug, das uns den heiligen Fluss hinabtragen
sollte, bestiegen. Diese Tsangpoboote sind ebenso einfach wie
praktisch. Man denke sich ein Gerippe, oder vielmehr ein Gestell
von dünnen, zähen Ästen und Rippen fest zusammengeschnürt
und mit vier aneinander genähten Yakhäuten überspannt,
die an einem Holzring, der die Reling bildet, befestigt werden
– und das Boot ist fertig! Es ist sehr plump, länglich
viereckig, aber vorn etwas schmäler als hinten. Schwer
ist es nicht, es bildet eine gewöhnliche Manneslast.“
Sven Hedin
erreicht Shigatse. Die Tibeter und ihre damaligen Schutzherren,
die Chinesen haben Probleme, wie sie diesen Eindringling aus
Europa behandeln sollen:
„Am 11.
Februar wurde ich früh um halb sieben mit der Nachricht geweckt,
dass zwei Herren mich sofort zu sprechen wünschten. Das Kohlenbecken
und warmes Wasser wurden gebracht, ich kleidete mich in größter
Eile an, im Zelt wurde aufgeräumt und gefegt, und dann
ließ ich die Gäste bitten, näher zu treten.
Der eine war ein hochgewachsener Lama von hohem Rang, er hieß
Lobsang Tsering und war einer der Sekretäre des Taschi-Lama:
der andere, Duan Suän, war ein junger Chinese mit feinen
, edlen Gesichtszügen. Beide waren außerordentlich höflich
und von feinen Manieren. Wir plauderten zwei Stunden lang über
alles mögliche; seltsamerweise schien meine Ankunft in
Shigatse beiden Herren eine vollkommene Überraschung zu
sein. Sie fragten wieder nach meinem Namen, nach dem Weg, auf
dem ich gekommen sei, und nach meiner Absicht; von dem armen,
kleinen Schwedenland hatten sie natürlich noch nie gehört,
schrieben sich aber seinen Namen schwedisch, englisch und chinesisch
auf.
„Ich habe
die Absicht, heute dem Neujahrsfest beizuwohnen“, sagte ich.
„Ich kann Shigatse nicht verlassen, ohne bei einem der größten
kirchlichen Feste zugegen gewesen zu sein.“
„Ein Europäer
hat unseren Festen, die nur für Tibeter und Pilger unseres Glaubens
sind, noch nie beigewohnt und wird auch nie die Erlaubnis erhalten,
sie sich anzusehen.“
„Der Pantschen
Rinpotsche (der heilige Lherr, der Taschi-Lama) muss doch seit
zwei Monaten von meinem Kommen unterrichtet sein? Seine Heiligkeit
hat auch gewusst, von welcher Seite ich kommen würde, sonst
hätte er mir nicht meine Post nach dem Dangra-jumtso schicken
können.“
„Der Pantschen
Rinpotsche befasst sich nie mit weltlichen Angelegenheiten;
alles das besorgt sein Bruder, der Herzog (Kung Guschuk).“
„Dennoch
muss ich seine Heiligkeit selber sehen; ich weiß, dass
er mich erwartet.“
„Nur einer
kleinen Anzahl Sterblicher ist es vergönnt, sich vor dem
Angesicht des Heiligen zeigen zu dürfen.“...
 |
| Tibeter
aus allen Schichten der Bevölkerung und eine offizielle
chinesische Abordnung besuchen das Fest |
Zu den
großen Tempelfesten haben alle Zutritt; man mahct keinen
Unterschied zwischen Geistlichen und Laien, Mönchen und
Nomaden, Reichen und Armen, Männern und Frauen, Greisen
und Kindern; man sieht das in Lumpen gehüllte Bettelweib neben
einer mit Edelsteinen übersäten Herzogin. Das Losar ist
ein Fest des ganzen Volkes. ...
Für mich
war es ein Glück, dass wir gerade rechtzeitig zm größten
Jahresfest des Lamaismus eingetroffen waren und bei seiner Feier
in der Kosterstadt Taschilunpo anwesend sein durften. Um halb
elf erschien Tsaktserkan, ein junger Kammerherr aus dem Vatikan,
in außerordentlich elegantem, gelbem Seidengewande und
mit einem Hut, der aussah wie eine umgekehrte Schüssel mit einer
herabhängenden Quaste, und erklärte, dass er von Seiner
Heiligkeit komme, mich zum Fest abzuholen, und dass er und der
Lama Lobsang Tsering beauftragt seien, während meines Aufenthaltes
in Shigatse mein persönliches Gefolge zu bilden. ER bat
mich aber, ja das Feinste, war ich hätte, anzuziehen, da
ich so sitzen würde, dass man mich die ganze Zeit über vom Platz
des Großlamas aus sehen könne. Ganz unten in einer
meiner Kisten hatte ich nun wirklich einen alten Grack, mehrere
Chemisetthemden und Lackschuhe, die ich eigens des Taschi-Lama
wegen mitgenommen hatte, und als Robert dann in einer anderen
Kiste mein Rasierzeug aufgestöbert hatte, nahm ich mich
auch inmitten der kahlen Berge Tibets wie ein veritabler Gentleman
aus Europa aus. ...
Wie in
den beiden vorhergehenden Jahren hatte das Neujahrsfest des
Jahres 1907 ein feierlicheres Gepräge als gewöhnlich,
und es hatte größere Pilgerscharen als früher herbeigelockt,
denn der Dalai-Lama war geflohen, als die Engländer nach
Lhasa zogen, und dieser Feigling unter den Päpsten weilte
jetzt, unverstanden und verachtet, in Urga, in der Mongolei,
nachdem er sein Land, wo alles drüber und drunter ging, den
andrägenden Nachbarn als Beute preisgegeben hatte. Manch
ein Pilger, der sonst nach Lhasa gezogen wäre, wallfahrte
jetzt lieber nach Taschilunpo, wo der Pantschen Rinpotsche,
der Papst von Tschang, auf seinem Posten geblieben war, als
das Land in Gefahr schwebte!
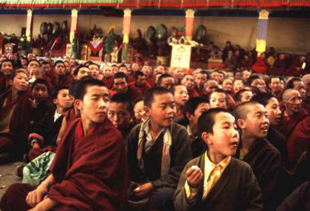 |
|
Mönche und Mönchs-Schüler
sind unter den Zuschauern der religiösen Tänze
und Zeremonien
|
Die Chinesen
hatten sogar eine umfangreiche Proklamation in Lhasa an allen
Streaßenecken ankleben lassen, worin sie den Dalai-Lama
für abgesetzt erklärten, weil er seine Untertanen, statt
sie zu verteidigen, ins Feuer geschickt und so den Tod vieler
Tausende verursacht habe, und worin der Taschi-Lama an siener
Stelle zum höchsten Leiter der inneren Angelegenheiten
Tibets ernannt wurde. Allerdings hatte der Pöbel diese
Proklamation zerrissen und in den Staub getreten, und allerdings
hatte der Taschi-Lama erklärt, dass er darauf nicht eingehen
werden; aber selbst jetzt noch, nach zwei und einem halben Jahr,
konnte man merken, dass der Taschi-Lama in unendlich viel höherem
Ansehen stand als der Dalai-Lama. Denn obgleich der Dalai-Lama
für allmächtig, allsehend und allwissend gilt, waren siene
Truppen von ungläubigen Fremdlingen geschlagen worden;
obgleich er seinen Kriegern Unverwundbarkeit versprochen hatte,
waren sie wie Fasanen von den englischen Mitrailleusen niedergeschossen
worden. ...
Jetzt beginnen
die religiösen Zeremonien. Der Taschi-Lama nimmt die Mitra
ab und reicht sie einen dienenden Bruder. ...
 |
| Einzug
ehrwürdiger Mönche und Musiker mit gelben Mitren, die
zur Bezeichnung „Gelbmützen-Mönche“ führten |
Nach einer
kurzen Pause ertönen wieder Posaunenstöße, und
nun erscheinen einige Lamas mit weißen Masken und weißen
Gewändern, Herolde einer Prozession von Mönchen, die
jeder irgendeinen gottesdienstlichen Gegenstand des Buddhismus
tragen, heilige Tempelgefäße, goldene Schalen und
Becher, Weihrauchfässer von Gold, die in ihren Ketten schaukeln
und aus denen wohlriechende Rauchwolekn aufsteigen. Einige dieser
Mönche treten in Harnisch und Rüstung auf, drei maskierte
Lamas sinken unter der Last ihrer außerordentlich kostbaren
Gewänder von roter, blauer und gelber goldgestickter Seide
beinahe zusammen.
Hinter
ihnen werden sechs mit Messing beschlagene, über 3 Meter lange
Kupferposaunen getragen; sie sind so schwer, dass ihr Schalltrichter
von einem Novizenknaben mit der Schulter gestützt werden muss.
Ihnen folgt eine Gruppe Flötenspieler, und dann kommen
vierzig phantastisch, bunt und kostbar gekleidete Männer,
die ihre auf einer geschnitzten Stange hoch in die Luft erhobene
und vertikal gehaltene Trommel mit einem schwanenhalsähnlichen
Trommelschlägel bearbeiten. Nun erscheinen die Zimbeln,
die taktfest und gellend in den Händen der in rote Seide
gekleideten Mönche schmettern. ...
 |
| Ein
Mönch in prachtvollem Seidengewand, bestickt mit Dämonengesichtern,
und mit einem Totenkopf auf dem Hut beginnt mit einem Kelch
in der Hand seinen mystischen Rundtanz |
Der Vorhang
oben an der steinernen Treppe öffnet sich, und eine maskierte
Gestalt, Argham genannt, tritt mit einer Schale voll Ziegenblut
in der Hand heraus. ER hält sie mit ausgestrecktem Arm
waagerecht, während er einen mystischen Rundtanz ausführt;
auf einmal gießt er das Blut über die Treppenstufen. Beide
Arme ausgestreckt und die Schale umgekehrt haltend, tanzt weiter,
während einige dienende Brüder herbeieilen, um das Blut
aufzuwischen. Ohne Zweifel ist diese Zeremonie noch ein Überbleibsel
aus der zeit, als in Tibet noch die ursprüngliche Bon-Religion
herrschte, bevor der irdische Mönche Padmasambhava im 8.
Jahrhundert n. Chr. Durch Einführung des Buddhismus in Tibet
den ersten Anlauf zur Begründung des Lamaismus nahm. Denn der
Lamaismus ist nur eine Arbart des reinen Buddhismus und hat
unter einer äußeren Politur buddhistischer Symbolik
eine Menge schiwaitischer Element aufgenommen und auch den Aberglauben,
der sich während der vorbuddhistischen Zeit in wilden,
fanatischen Teufelstänzen, Zerenomien und Opfern aussprach,
beibehalten. Der Zweck jener Zeremonien war die Beschwörung,
Verjagung und Versöhnung der mächtigen Dämonen,
die über alles in der Luft, auf der Erde und im Wasser herrschen
und deren einzige Aufgabe es ist, die Menschenkinder zu peinigen,
zu quälen und zu verfolgen. Damals wurden der Kriegsgott
und die Dämonen auch durch Menschenopfer milde gestimmt;
und die Zeremonie, die ich eben beschrieben habe, ist sicherlich
noch ein Überrest jener Opfer. ...
Bagtscham
heißt ein Tänzer in fürchterlicher Teufelsmaske;
als er sich im Kreis über den Hof hinbewegt, flattern bunte
Zeugstücke nach allen Seiten hin. Ihm folgen elf verlarvte Tänzer,
die dieselbe Bewegung ausführen. Zu ihnen gesellt sich dann
eine Schar neuer Schauspieler in bunten Gewändern mit Halsbändern,
Perlen und Schmucksachen. Sie tragen einen viereckigen Schulterkragen
mit einem runden Loch in der Mitte, der über den Kopf gezogen
wird, so sass der Kragen auf dne Schultern ruht und, wenn sie
tanzen, horizontals absteht. Eine große Menge bunter Lappen,
die sie um den Leib befestigt haben, weht auch wie die Räcke
einer Balletteuse, wenn die Tänzer sich im Kreise drehen.
In den Händen halten sie verschiedene religiöse Gegenstände
und lange, leichte Zeugenden, Bänder und Wimpel.
 |
| Tänzer
in Teufelsmasken (oder sollen das etwa Europäer sein?) |
Wieder
öffnet sich der Vorhang, und hinter zwei voranschreitenden
Flötenspielern zeigt sich oben an der Treppe Tschödschal
Ium, der Darsteller eines weiblichen Geisterwesens, und führt
mit einem Dreizack in der Hand auf der obersten Treppenstufe
einen Tanz aus. Schließlich tanzen Lamas in abscheulichen
Teufelsmasken mit großen, bösen Augen und mephistophelischen
Augenbrauen. ...
Bei jeder
neuen Nummer klingeln die drei Oberpriester mit ihren Glocken,
und ununterbrochen lärmt die Musik, die mit ihrem misstönenden
Spektakel von den steinernen Fassaden des eingen Hofes dröhnend
widerhallt. Taktfest und langsam schlagen die Trommelschläger
ihre Trommeln, begleitet von dem schmetternden Geklapper der
Zimbeln, den unheimlichen, langgezogenen Posaunenstößen
und den einschmeichelnden Flötentönen. Aber von Zeit
zu Zeit wird das tempo beschluenigt, die Trommelschläge
donnern immer dichter hintereinander, und das Klappern der aneinandergeschlagenen
Becken verschmilzt in ein einziges ununterbrochenes Getöse.
Die Musikanten scheinen sich gegenseitig anzustacheln, es geht
im Crescendo; man kann schon bei weingier Lärm taub werden,
und es ist daher nicht der Mühe wert, zu versuchen, mit seinen
Nachbarn zu reden. Dabei wird auch in schnellerem Takt getanzt.
Das fanatische Schauspiel macht ohne Zweifel einen tiefen Eindruck
auf die Anwesenden. ...
Das Gaukelspiel,
dem ich beigewohnt hatte, war in jeder Beziehung glänzend,
farbenreich und prachtvoll, und man kann sich sehr wohl denken,
welch demütige Gefühle der einfache Pilger aus dem öden
Gebirge oder den stillen Tälern einer solchen Schaustellung
gegenüber haben wird.
Wenn es
der ursprüngliche Sinn dieser dramatischen Maskeraden und dieser
mystischen Spiele ist, fiendliche Dämonen zu beschwören
und zu vertreiben, so besitzt die Geistlichkeit in ihnen doch
ein Mittel, um die leichgläubigen Massen im Netz der Kirche
festzuhalten, und gerade dies ist , sowohl für die Kirche wie
für die Priester, eine Lebensbedingung.
Nichts imponiert der Unwissenheit so sehr wie Schreckensszenen
aus der Welt der Dämonen, und daher sind Teufel und Ungeheuer
bei den öffentlichen Maskenraden der Köster reich
vertreten. Mit ihrer Hilfe und durch Darsteelungen des „Todeskönigs“
Yama und der firedlos umherirrenden Seelen, die in der Kette
der Seelenwanderung vergeblich nach einer neuen Daseinsform
suchen, ängstigen die Mönche die große Menge,
machen sie verzagt und nachgiebig und zeigen manchem armen Sünder,
welche Widerwärtigkeiten und welche Geißel auf dem
holperigen Weg zum Nirwana seiner im Tal der Todesschatten warten.“
 |
 |
| Meterlange
Posaunen und vertikal stehende Trommeln sorgen für eine
lärmende Musik |
Ranghöchster
Zuschauer ist im Kreise seiner Lehrer dieser kleine Junge,
die Reinkarnation eines hohen Lama |

