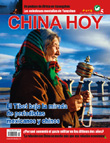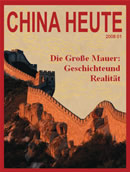Typisch deutsch und typisch chinesisch?
Von Wang Liping
„Was ist Ihrer Meinung nach typisch deutsch und was ist typisch chinesisch, meine sehr geehrten chinesischen Freunde und deutschen Landsleute?", fragte kürzlich ein Sinologe bei einem Zusammentreffen von Chinesen und Deutschen in Berlin. „Möchten Sie lieber zuerst die negativen und kritischen oder die positiven Ansichten hören?", fragte eine junge Studentin den Moderator. „Bitte das Kritische zuerst", antwortete der Sinologe ohne zu zögern. „Typisch deutsch!", fiel ihm eine junge Akademikerin ins Wort, als ob sie die Antwort vorher schon gewusst hätte. „Vielen Dank für die erste Meldung! Sie haben meine Gedanken gelesen!" Der Sinologe war überrascht. „Nein, habe ich nicht. Ich wurde nur mehrmals aufgefordert, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und jedes Mal hörte ich dieselbe Reaktion wie die von Ihnen. Aber ich weiß nicht, warum die Deutschen die kritischen Meinungen bevorzugen. Wir Chinesen würden ganz im Gegenteil reagieren", erklärte die junge Frau und gab die Frage an den Moderator zurück. „Ihre Frage ist zu gut, als dass ich sie nicht mit einer Antwort verderben möchte. Ich kann nur sagen, dass wir scheinbar alle Kants Seelenverwandte sind und dazu neigen, alles kritisch zu betrachten. Die Chinesen sind, so weit ich weiß, dank ihrer schönen und feinen Sprache Meister der Rhetorik. Sie können die Kritik so gut in süße Wörter wickeln, dass man sie ohne weiteres als Lob annehmen kann. So habe ich es bei den ersten Begegnungen mit Chinesen erlebt und mich herzlich für die Kritik, die aber als Lob verkleidet war, bedankt. War das dumm von mir? Aber gerade dadurch habe ich aus Unkenntnis die Zuneigung der Chinesen erhalten. Sie dachten, ich sei ein bescheidener Junge und habe offene Ohren für Kritik." Mit dieser lustigen Geschichte begann der Gedankenaustausch und die Diskussion in einer freundlichen und lockeren Atmosphäre.
„Ich möchte das Sprach-Thema weiter ausführen", meldete sich eine Architektin aus Beijing zu Wort, „Ich möchte mit zwei verschiedenen Baustilen, als Gleichnis, die Sprachkunst der Deutschen und der Chinesen vergleichen, wenn meine lieben deutschen Freunde überhaupt eine Sprachkunst zur Verfügung haben." „Wie bitte?" Die anwesenden Deutschen waren anscheinend mit dem letzten Satz nicht einverstanden. „Bitte vergessen Sie nicht Goethe, Schiller, Mann, Grass...", wandte einer von ihnen ein. „Danke für Ihren Hinweis! Ich habe mich nicht ganz klar ausgedrückt. Ich meine mit der Sprachkunst nicht die klassische Literatur, sondern die alltägliche Kommunikation." Diese Ergänzung hatte die kleine Aufregung beigelegt. „Ich bin seit einem Jahr in Berlin. Als Architektin habe ich in China und in Deutschland viele Paläste besichtigt. Meiner Beobachtung nach repräsentiert der Baustil der Paläste nicht nur die Pracht der ehemaligen königlichen oder kaiserlichen Residenzen, sondern er stellt auch ein ästhetisches Ideal dar, was wiederum die Denkweise der beiden Völker widerspiegelt. Als Beispiel nehme ich zwei berühmte Paläste in Potsdam und in Beijing: Sanssouci und die Verbotene Stadt. Beide sind herrlich eingerichtet. Aber wenn man in Sanssouci mehrere Treppen und die Weinplantage hinter sich hat, steht die vordere Fassade mit mehreren Raumabteilungen und Fenstern vor den Augen. Bevor man hineintritt, hat man schon einen sehr klaren Überblick. Was die hintere Fassade zeigt, ist noch klarer: Nichts. Es steht dort nichts, keine anderen zwei oder drei Paläste hinter diesem Gebäude. Genauso ist die Art und Weise, wie die meisten Deutschen, die ich kenne, reden. Wenn sie ihre Meinungen äußern, drücken sie diese genau und deutlich, ohne Hintergedanken so aus, als ob sie mit dieser direkten Meinung, meistens Kritik, die Zuhörenden verletzen würden. ,Was meinen Sie damit?' ist deshalb eine häufig gebrauchte Redewendung, wie auf Chinesisch die äquivalente Übersetzung ,ni shenme yisi?' Zu der auf deutsch gestellten Frage würde ein Deutscher antworten: „Ich meine, was ich eben schon wörtlich ausgedrückt habe." Zur selben Frage würde aber einem Chinese sofort klar, dass er vielleicht mit seiner Äußerung die Anderen bewusst oder unbewusst verletzt hat. Statt den Hintersinn seiner Äußerung zu erklären, würde er sich zuerst entschuldigen. Ein chinesischer Satz enthält mehrere Hinterräume, die mehrfache Interpretationen zulassen. Wie der chinesische Palastkomplex, einer hinter dem anderen."
|

|
| Schloss Sanssouci in Potsdam |
|

|
| Mittagstor der Verbotenen Stadt in Beijing |