Buchbesprechung:
Sitten und Gebräuche in Tibet
Von Shu Ping
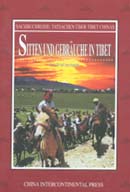
Sitten und Gebräuche in Tibet ist ein Titel aus der
Sachbuchreihe: Tatsachen über Tibet. Das Buch hat acht Hauptkapitel:
„Wohnkultur“, „Trink- und Essgewohnheiten“,
„Kleidungssitten“, „Eheschließung und Hochzeitsbräuche“,
„Feste und Bräuche“, „Religiöse Sitten“,
„Vergnügungssitten“ und „Bestattungsriten“.
An diesen Überschriften ist zu erkennen, dass die Autoren
ein breites Spektrum tibetischen Brauchtums präsentieren.
Die einzigartigen Sitten und Bräuche in Tibet sind laut Autoren
aus gemeinsamen historischen Prozessen, aus gleicher Kulturentwicklung
und Naturbedingung sowie aus gemeinsamer Auffassung über
Gottheiten entstanden. Sie sind deswegen für Ethnologen,
Soziologen und andere Wissenschaftler sowie gewöhnliche Besucher
in Tibet interessant, weil sie von verschiedenen überlieferten
Äußerungsformen der kulturellen Tradition und des derzeitigen
gesellschaftlichen Lebens der Tibeter zeugen.
Ausführlich beschrieben ist der religiöse Aspekt der
Sitten und Gebräuche der Tibeter. Denn „das religiöse
Bekenntnis und die Göttervorstellung haben Lebensgewohnheiten
und Verhaltensregeln der tibetischen Nationalität geprägt.“
Sowohl die Bon-Religion, die aus dem tibetischen Altertum überliefert
war und durch den Animismus gekennzeichnet ist, als auch der verhältnismäßig
später entstandene tibetische Buddhismus spielen heute eine
wichtige Rolle im Leben der Angehörigen der tibetischen Nationalität.
Die meisten tibetischen Feste haben Wurzeln in der Religion. Die
Autoren weisen darauf hin, dass der Naturkult und die Verehrung
verschiedener Gottheiten und nicht zuletzt die Verbreitung des
tibetischen Buddhismus wichtige Gründe für die Vielzahl
der tibetischen Feste bilden. Selbst wenn ein Fest eine profane
Bezeichnung in Tibet hat, so steht es in engem Zusammenhang mit
der Ausübung der Religion. Als Beispiel sei hier das Shoton-Fest
genannt. „Shoton“ bedeutet hier auf Tibetisch „Sauermilch“.
Es ist darauf zurückzuführen, dass vor dem 17. Jahrhundert
die buddhistischen Mönche nach dem religiösen Fasten
Sauermilch als Spenden von den Bewohnern bekamen. Aus dieser Tradition
hat sich ein Fest entwickelt, welches noch heute mit der Aufführung
der tibetischen Oper begangen wird. Das Shoton-Fest wird heute
als immaterielles Kulturerbe Tibets angesehen.
Bei der Darstellung der Gesamtheit der Sitten und Bräuche
gehen die Autoren auf die regionalen Differenzen ein. Da es in
Tibet ländliche Gebiete mit Ackerbau und mit Viehwirtschaft
gibt, haben sich „die Qingke-Gerste-Kultur und die Jak-Kultur“
herausgebildet. Sie äußern sich in unterschiedlicher
Wohnkultur, unterschiedlichen Trink- und Essgewohnheiten sowie
Kleidungssitten. Beispielsweise wohnt man in den Viehzuchtgebieten
häufig in Jurten, während man in den Agrargebieten und
Städten meist in wachturmförmigen Häusern wohnt.
Auch diese sind von Ort zu Ort verschieden. Die Autoren haben
die Baustile an Orten wie z. B. in Lhasa, in Shannan und Ngari
beschrieben und die Gründe für den Unterschied dargelegt.
Auch unterschiedliche Sekten des tibetischen Buddhismus haben
neben den großen religiösen Festen ihre eigenen Feste.
Beispielsweise feiert die Gelug-Sekte im zweiten Monat nach dem
tibetischen Kalender das Kleine Gebetsfest, am 25. Tag des zehnten
Monats den Todestag von Tsongkhapa, Begründer dieser Sekte,
und im zwölften Monat das Göttertanzfest des Potala-Palastes.
Das ganze Jahr hindurch werden insgesamt etwa einhundert Feste
an verschiedenen Orten in Tibet gefeiert. Es wird deutlich, dass
die Sitten und Bräuche in Tibet dadurch gut bewahrt und fortgeführt
werden.
Erwähnenswert sind die zahlreichen professionellen Aufnahmen
in diesem Buch. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich auf
die Texte beziehen und verschiedene Aspekte des tibetischen Brauchtums
detailliert illustrieren.
Li Tao und Jiang Hongying: Sitten und
Gebräuche in Tibet, China Intercontinental Press 2005.
ISBN 7-5085-0663-4/K.598
|







